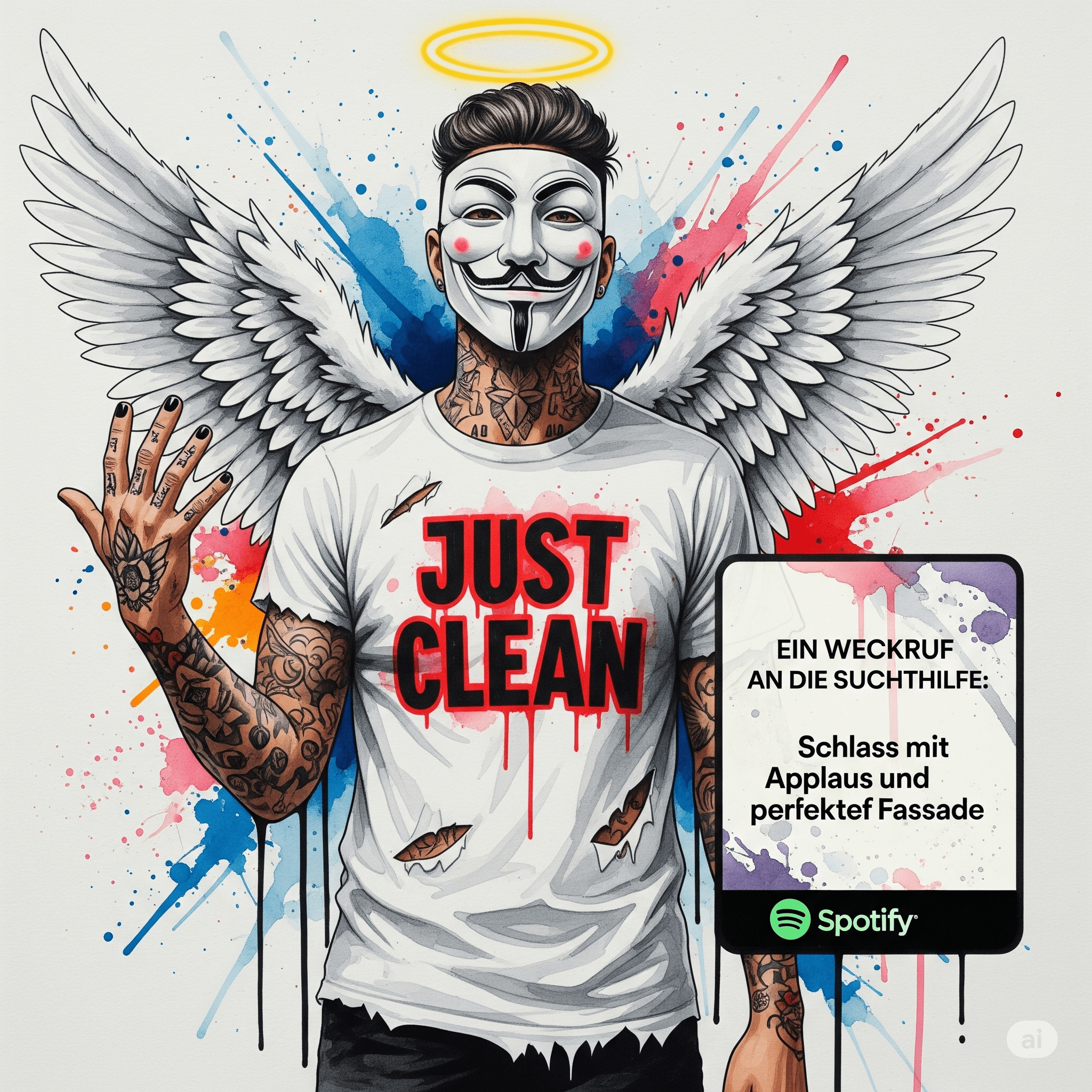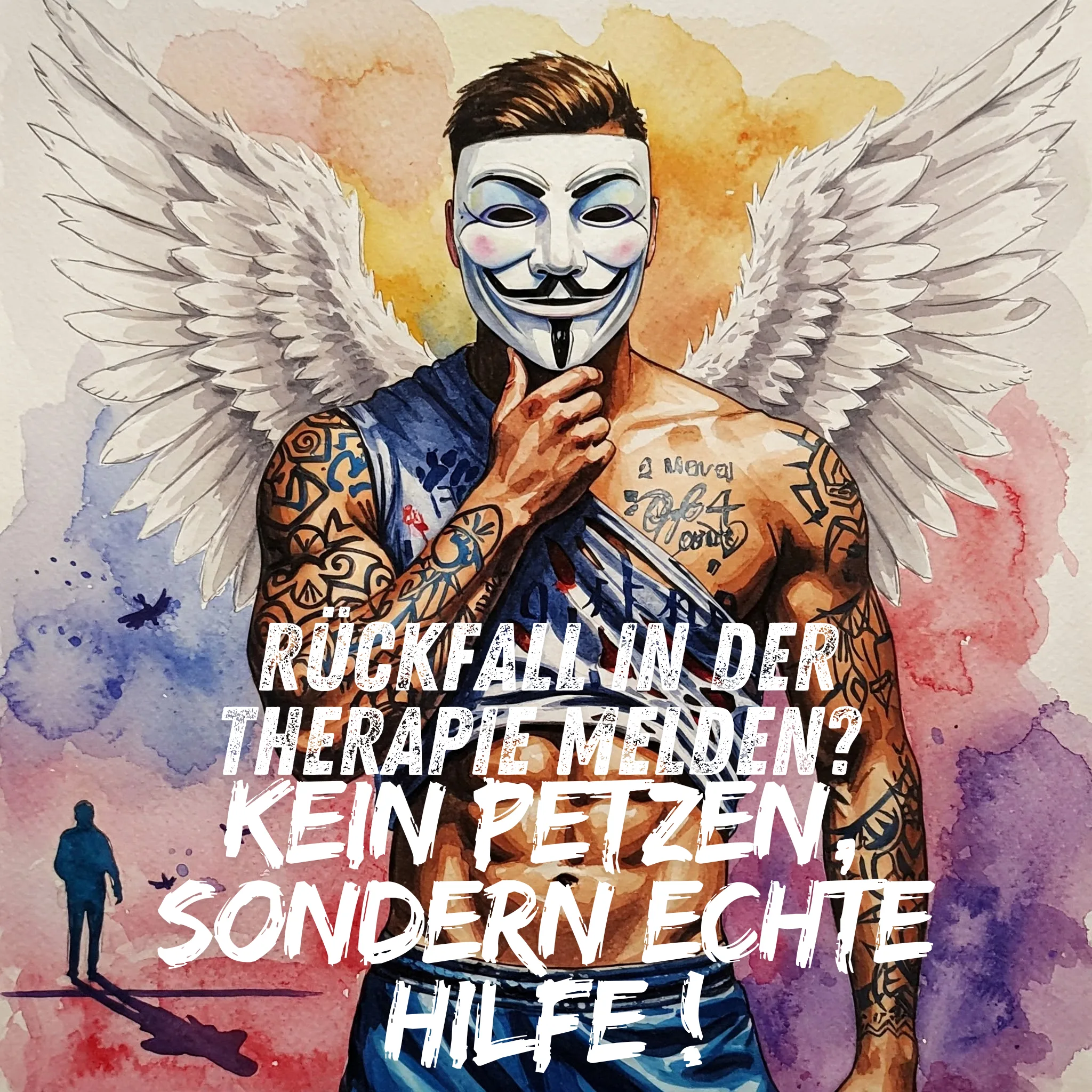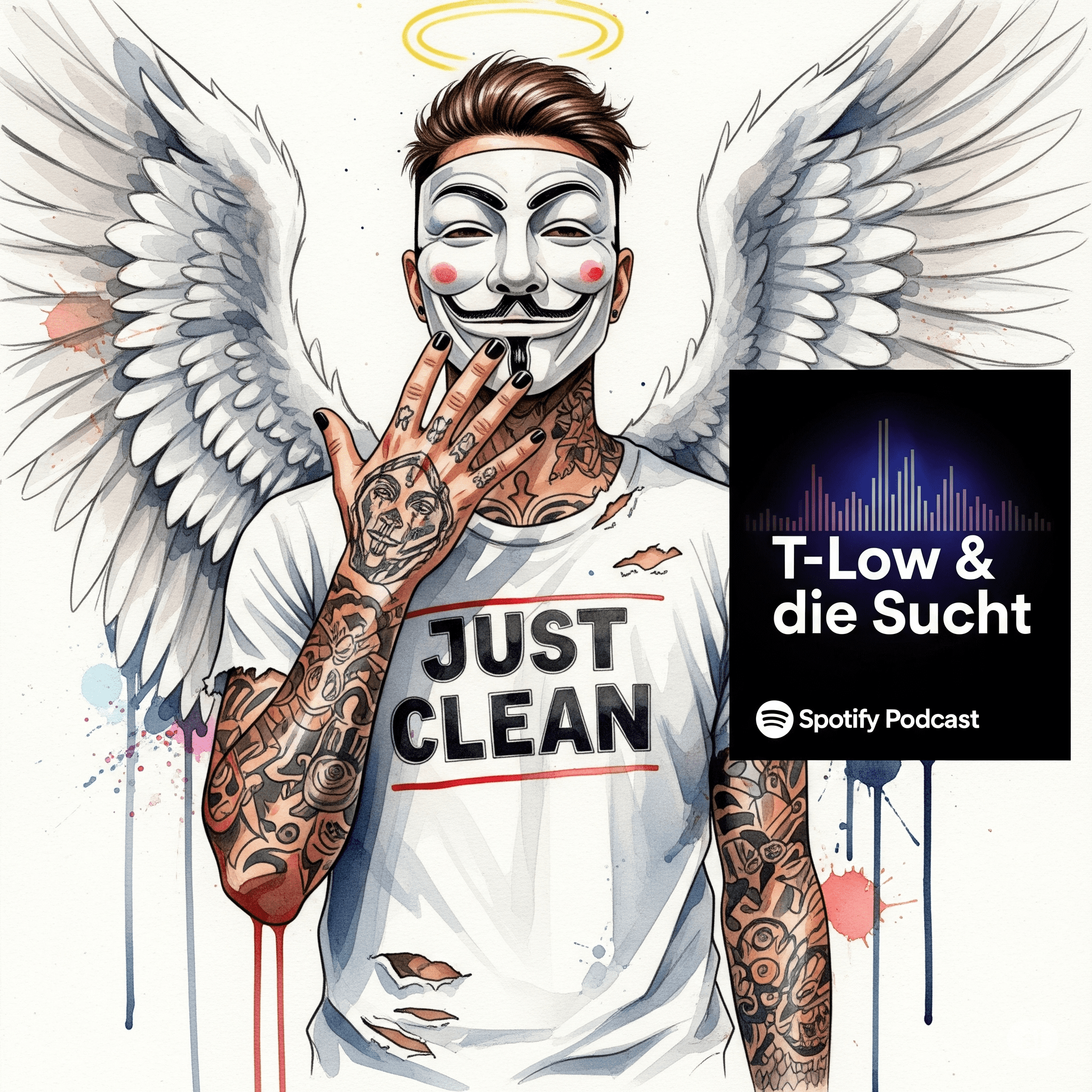Sucht ist ein Thema, das viele Menschen betrifft, sei es direkt oder indirekt. Sie ist eine Krankheit , die das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen stark beeinträchtigen kann. In diesem Blogbeitrag wollen wir uns mit substanzgebundenen Süchten auseinandersetzen, ihre Ursachen und Auswirkungen beleuchten und verschiedene Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen.
Was sind substanzgebundene Süchte?
Substanzgebundene Süchte entstehen durch den Konsum von psychoaktiven Substanzen, die die Wahrnehmung, das Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Diese Substanzen wirken auf das Belohnungssystem im Gehirn, indem sie die Ausschüttung von Botenstoffen wie Dopamin verändern und dadurch ein künstliches Glücksgefühl erzeugen. Mit der Zeit gewöhnt sich der Körper an diese Stimulation, und es entsteht eine Toleranz. Das bedeutet, dass Betroffene immer größere Mengen der Substanz benötigen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Gleichzeitig entwickelt sich eine psychische Abhängigkeit, die durch ein starkes Verlangen nach der Substanz gekennzeichnet ist.
Zu den substanzgebundenen Süchten gehören unter anderem:
- Alkoholsucht: Alkohol ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet und akzeptiert. Doch für manche Menschen wird der Konsum zur Gewohnheit und schließlich zur Sucht. Rund 330.000 Menschen in Österreich sind alkoholkrank.
- Nikotinsucht: Nikotin ist der suchtauslösende Stoff in Tabakprodukten. Es führt zu einer starken körperlichen und psychischen Abhängigkeit und ist sogar stärker abhängig machend als Marihuana.
- Drogensucht: Illegale Drogen wie Cannabis, Heroin oder Kokain wirken stark auf das Gehirn und können schnell abhängig machen. Der Besitz, Erwerb, Handel und die Herstellung dieser Substanzen ist nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten.
- Medikamentensucht: Auch Medikamente, insbesondere Schlaf- und Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine, können abhängig machen, wenn sie über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.
Ursachen und Risikofaktoren
Die Entstehung einer Suchterkrankung ist ein komplexer Prozess, bei dem verschiedene Faktoren zusammenspielen. Das sogenannte biopsychosoziale Modell beschreibt diesen Prozess als ein dynamisches Wechselspiel zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Einflüssen.
Biologische Faktoren: Eine genetische Veranlagung kann das Risiko für eine Sucht erhöhen. Studien haben gezeigt, dass Kinder suchtkranker Eltern ein höheres Risiko haben, selbst eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Auch Veränderungen im Gehirn, die durch den Substanzkonsum hervorgerufen werden, tragen zur Suchtentwicklung bei. Suchtmittel aktivieren im sogenannten limbischen System, das für unser Wohlbefinden zuständig ist, verschiedene Botenstoffe, insbesondere Dopamin. Die erhöhte Ausschüttung dieser Botenstoffe erzeugt den Belohnungseffekt, der für die suchttypische Euphorie verantwortlich ist.
Psychologische Faktoren: Menschen mit geringem Selbstwertgefühl, Ängsten oder Depressionen haben ein erhöhtes Risiko, eine Sucht zu entwickeln. Die Substanz wird oft als Mittel zur Stressbewältigung oder zur Flucht vor Problemen eingesetzt. Traumatische Erlebnisse und ungelöste Konflikte, insbesondere aus der Kindheit, können ebenfalls eine Rolle spielen.
Soziale Faktoren: Ein Umfeld, in dem Drogenkonsum akzeptiert oder sogar gefördert wird, kann die Entstehung einer Sucht begünstigen. Auch Gruppenzwang, insbesondere bei Jugendlichen, spielt eine Rolle. Die leichte Verfügbarkeit von Suchtmitteln, wie Alkohol oder Nikotin, erhöht das Risiko für eine Abhängigkeit.
Symptome und Auswirkungen
Die Symptome einer Suchterkrankung sind vielfältig und können sich sowohl körperlich als auch psychisch äußern. Zu den typischen Anzeichen gehören:
- Starkes Verlangen nach der Substanz (Craving)
- Kontrollverlust über den Konsum
- Entzugserscheinungen bei Abstinenz
- Toleranzentwicklung
- Vernachlässigung von Hobbys, sozialen Kontakten und beruflichen Pflichten
- Fortsetzung des Konsums trotz negativer Folgen
- Einengung auf den Substanzgebrauch
Darüber hinaus können alltägliche Situationen und Reize, die mit dem Substanzkonsum verbunden sind, ein starkes Verlangen (konditionierte Reaktion) auslösen und zu Rückfällen führen.
Soziale Auswirkungen von Sucht
Sucht belastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihr soziales Umfeld. Beziehungen zu Familie und Freunden leiden unter dem unberechenbaren Verhalten, den Stimmungsschwankungen und den Lügen, die oft mit der Sucht einhergehen. Es kann zu sozialer Isolation und zum Verlust des Arbeitsplatzes kommen.
Ein weiteres Problem ist die Co-Abhängigkeit. Angehörige von Suchtkranken versuchen oft, die Sucht zu vertuschen, zu entschuldigen oder zu kontrollieren. Dadurch übernehmen sie die Verantwortung für das Verhalten des Suchtkranken und ermöglichen ihm, die Sucht fortzusetzen. Co-Abhängigkeit kann die Genesung des Suchtkranken behindern und die Angehörigen selbst in eine psychische Belastung führen.
Behandlungsmöglichkeiten
Eine Suchterkrankung ist eine ernstzunehmende Krankheit, die professionelle Hilfe erfordert. Die Behandlung sollte individuell auf den Betroffenen abgestimmt sein und verschiedene Maßnahmen umfassen.
Phasen der Behandlung:
- Motivationsphase: In dieser Phase geht es darum, die Betroffenen für eine Therapie zu motivieren und ihnen die Notwendigkeit einer Behandlung aufzuzeigen.
- Entgiftungsphase: Bei körperlicher Abhängigkeit ist zunächst eine Entgiftung notwendig, um den Körper von der Substanz zu befreien. Diese sollte unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, da der Entzug in manchen Fällen lebensgefährlich sein kann.
- Entwöhnungsphase: In dieser Phase lernen die Betroffenen, ein Leben ohne Suchtmittel zu führen. Sie setzen sich mit den Ursachen ihrer Sucht auseinander und entwickeln neue Bewältigungsstrategien.
- Nachsorgephase: Die Nachsorge soll den Betroffenen helfen, Rückfälle zu vermeiden und ihre Abstinenz langfristig zu stabilisieren.
Methoden der Behandlung:
- Psychotherapie: Die Psychotherapie hilft den Betroffenen, die Ursachen ihrer Sucht zu verstehen und neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Verschiedene Therapieformen kommen zum Einsatz, z.B. die kognitive Verhaltenstherapie.
- Selbsthilfegruppen: Der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen kann eine wertvolle Unterstützung sein.
- Medikamente: In manchen Fällen können Medikamente eingesetzt werden, um Entzugserscheinungen zu lindern oder das Verlangen nach der Substanz zu reduzieren.
Prävention
Suchtprävention setzt an verschiedenen Ebenen an, um die Entstehung von Suchterkrankungen zu verhindern.
- Information und Aufklärung: Es ist wichtig, über die Risiken des Substanzkonsums aufzuklären, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.
- Förderung von Lebenskompetenzen: Die Stärkung des Selbstwertgefühls, der Stressbewältigung und der sozialen Kompetenzen kann dazu beitragen, dass Menschen gar nicht erst zur Substanz greifen. Schutzfaktoren wie ein gesundes Selbstwertgefühl, ein positives Familienumfeld und gute soziale Beziehungen können die Widerstandsfähigkeit gegenüber Sucht erhöhen.
- Gesundheitsförderliche Lebensbedingungen: Die Schaffung von positiven Lebensbedingungen, z.B. in Familie, Schule und Beruf, kann das Risiko für Sucht verringern.
- Schadensminimierung (Harm Reduction): Diese Strategie zielt darauf ab, die negativen Folgen des Substanzkonsums zu reduzieren, ohne den Konsum selbst zu verbieten. Beispiele für Harm Reduction sind Spritzentauschprogramme oder Drug-Checking-Angebote.
Eine Geschichte von Sucht und Verlust
Maria war eine erfolgreiche Anwältin mit einem scheinbar perfekten Leben. Doch hinter der Fassade der starken Frau verbarg sich eine tiefe Unsicherheit. Schon in ihrer Kindheit hatte sie gelernt, ihre Gefühle mit Alkohol zu betäuben. Der Druck im Job und die hohen Erwartungen an sich selbst verstärkten ihre Abhängigkeit. Maria trank immer mehr, vernachlässigte ihre Arbeit und ihre Familie. Sie log und manipulierte, um ihre Sucht zu verbergen. Erst als sie ihren Job und ihre Familie verlor, erkannte sie die Schwere ihrer Erkrankung. Mit professioneller Hilfe und der Unterstützung einer Selbsthilfegruppe gelang es ihr schließlich, den Weg aus der Sucht zu finden. Doch die Narben, die die Sucht hinterlassen hatte, blieben.
Persönliche Geschichten
Sucht betrifft Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Die persönlichen Geschichten von Betroffenen zeigen, wie die Sucht das Leben verändern kann und welche Herausforderungen der Weg aus der Abhängigkeit mit sich bringt. So erzählt Lorenz Gallmetzer, ein ehemaliger ORF-Korrespondent, in seinem Buch „Süchtig: Von Alkohol bis Glücksspiel: Abhängige erzählen“ von seinem eigenen Kampf gegen den Alkoholismus und den Geschichten anderer Betroffener.
Schlussfolgerung
Substanzgebundene Süchte sind ein komplexes Problem mit weitreichenden Folgen. Es ist wichtig, die Krankheit zu erkennen, Hilfe zu suchen und die Betroffenen zu unterstützen. Prävention spielt eine entscheidende Rolle, um die Entstehung von Sucht zu verhindern. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, mit Suchtproblemen zu kämpfen hat, zögern Sie nicht, sich Hilfe zu suchen. Es gibt zahlreiche Anlaufstellen, wie Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegruppen und Therapieeinrichtungen, die Unterstützung anbieten.
Hilfreiche Links:
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS): www.dhs.de
- Österreichischer Suchthilfekompass: www.suchthilfekompass.at
- Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht: www.infodrog.ch