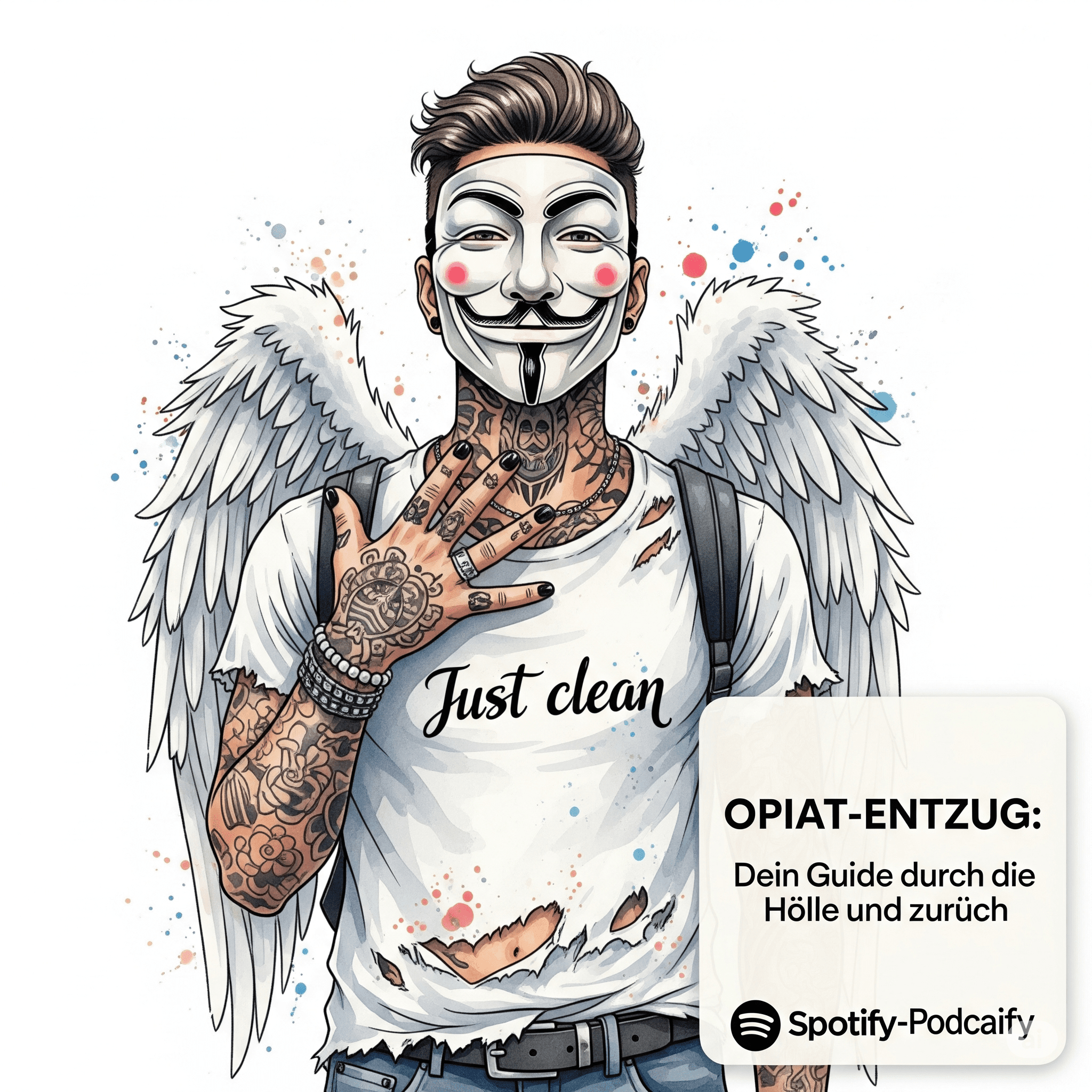Hey Du,
heute reden wir über den „Affen“ – den qualvollen, körperlichen und seelischen Zustand, der eintritt, wenn man versucht, von Opiaten loszukommen: den Opiat-Entzug.
Es ist einer der härtesten Kämpfe, den ein Mensch durchmachen kann. Aber es ist auch der erste, unumgängliche Schritt auf dem Weg zurück in ein echtes, fühlendes Leben. Lass uns beleuchten, was da in deinem Körper passiert und wie du es überleben kannst.
Was passiert bei einem Opiat-Entzug im Gehirn? 🧠
Stell dir vor, dein Gehirn hat seinen eigenen „Wohlfühl-Regler“ (das Endorphin-System). Opiate drehen diesen Regler von außen auf eine unnatürliche, maximale Lautstärke. Um nicht durchzubrennen, reagiert dein Gehirn auf zwei Arten:
- Es stellt die eigene Produktion von Wohlfühl-Stoffen fast komplett ein.
- Es wird unempfindlicher gegenüber den Opiaten.
Wenn du jetzt die Droge wegnimmst, bricht das System zusammen. Du hast keine Droge von außen mehr UND kaum noch eigene Wohlfühl-Stoffe. Gleichzeitig schreien alle Systeme, die von den Opiaten unterdrückt wurden (wie das Stress-System Noradrenalin), mit voller Lautstärke los. Das Ergebnis ist die Hölle.

Die Symptome: Die schlimmste Grippe deines Lebens (mal 100) 🤒
Ein Opiat-Entzug fühlt sich an wie eine extreme Grippe auf Steroiden. Die Symptome sind sowohl körperlich als auch psychisch.
Körperliche Entzugserscheinungen:
- Extreme Muskelschmerzen und Knochenschmerzen
- Unkontrollierbares Zittern und Muskelzuckungen
- Anhaltende Gänsehaut („Cold Turkey“) und Schüttelfrost
- Hitzewallungen und starkes Schwitzen
- Laufende Nase, tränende Augen, ständiges Gähnen
- Magenkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
- Massive Schlafstörungen und körperliche Unruhe (besonders „Restless Legs“)
Psychische Entzugserscheinungen:
- Überwältigendes Verlangen nach der Droge (Craving)
- Extreme Angstzustände und Panikattacken
- Tiefe Depression und Hoffnungslosigkeit
- Starke Reizbarkeit und Aggressivität
- Suizidgedanken
Die Timeline: Heroin vs. Methadon – Nicht jeder Entzug ist gleich ⏳
- Kurzwirksame Opiate (z.B. Heroin, Tilidin): Der Entzug beginnt schnell (nach ca. 6-12 Stunden), erreicht seinen Höhepunkt nach 2-3 Tagen und die schlimmsten körperlichen Symptome klingen nach 5-7 Tagen langsam ab.
- Langwirksame Opioide (z.B. Methadon, Polamidon, Substitol): Der Entzug beginnt viel später (nach 24-48 Stunden), baut sich langsamer auf, ist aber dafür extrem langwierig. Er kann sich über mehrere Wochen oder sogar Monate hinziehen, was ihn zu einer unglaublichen Zerreißprobe macht.
Nach dem Entzug ist vor dem Entzug? Was ist PAWS?
Zusatzinfo: Post-Akutes Entzugssyndrom (PAWS)
Selbst wenn der akute, körperliche Entzug überstanden ist, ist es nicht vorbei. Viele Betroffene leiden monate- oder sogar jahrelang am Post-Akuten Entzugssyndrom (PAWS).
Das sind anhaltende, oft in Wellen auftretende Symptome wie:
- Anhaltende Depression & Angst
- Stimmungsschwankungen & Reizbarkeit
- Schlafstörungen
- Antriebslosigkeit & Konzentrationsprobleme
Zu wissen, dass es PAWS gibt, ist wichtig, damit du nicht denkst, du wärst „verrückt“ oder würdest es „nie schaffen“, nur weil du dich auch nach Monaten noch oft schlecht fühlst. Es ist Teil des langen Heilungsprozesses deines Gehirns.

Behandlung & Hilfe: Wie du den Entzug überleben kannst 🙏
Ein Opiat-Entzug sollte niemals allein und immer unter ärztlicher Aufsicht stattfinden!
- Qualifizierter Entzug in einer Klinik: Das ist der sicherste Weg. Hier werden deine Vitalfunktionen überwacht und du bekommst Medikamente (z.B. Clonidin gegen die vegetativen Symptome), um die Hölle erträglicher zu machen.
- Substitutionstherapie: Für viele ist der direkte Entzug keine Option. Eine Substitution mit Methadon, Polamidon oder Buprenorphin ist dann der lebensrettende Weg, um zu stabilisieren.
- Psychotherapie: Ein Entzug ohne anschließende Therapie, die die Ursachen der Sucht behandelt, ist fast immer zum Scheitern verurteilt.
Fazit: Der harte, aber notwendige Weg zurück ins Leben
Der Opiat-Entzug ist ein brutaler, schmerzhafter Prozess. Aber er ist der unausweichliche Preis für die Freiheit. Es ist der Weg zurück zu echten Gefühlen, zu einem selbstbestimmten Leben und raus aus dem Gefängnis der Sucht. Du musst diesen Weg nicht allein gehen. Hol dir professionelle Hilfe.
Häufige Fragen (FAQ) zum Opiat-Entzug
Ist ein kalter Opiat-Entzug zu Hause gefährlich?
Während ein Opiat-Entzug für einen ansonsten gesunden Menschen seltener direkt tödlich ist als z.B. ein Alkohol- oder Benzo-Entzug, ist er dennoch extrem gefährlich. Der massive Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen und Durchfall kann zu einem Kreislaufkollaps führen. Die psychische Belastung ist so enorm, dass das Risiko für selbstverletzendes Verhalten oder Suizidhandlungen hoch ist. Ein Entzug sollte immer ärztlich begleitet werden.
Was ist der Unterschied zwischen einem Heroin- und einem Methadon-Entzug?
Der Hauptunterschied ist die Dauer. Ein Heroin-Entzug ist kurz und extrem heftig („wie eine Explosion“). Die schlimmsten körperlichen Symptome sind meist nach einer Woche überstanden. Ein Methadon-Entzug ist viel langgezogener und zermürbender. Er beginnt langsamer, ist in seinen Spitzen oft weniger intensiv als ein kalter Heroin-Entzug, zieht sich aber über viele Wochen hin.
Ich bin seit Monaten clean, fühle mich aber immer noch oft depressiv und unruhig. Ist das normal?
Ja, das ist leider sehr normal und hat einen Namen: Post-Akutes Entzugssyndrom (PAWS). Dein Gehirn braucht sehr lange Zeit, um seine Chemie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Anhaltende Stimmungsschwankungen, Depressionen, Ängste und Schlafstörungen können monate- oder sogar jahrelang in Wellen auftreten. Es ist wichtig, das zu wissen, geduldig mit sich zu sein und weiterhin Unterstützung (Therapie, Selbsthilfegruppen) zu nutzen.