Hey Du,
wir haben über den Zusammenhang von Sucht und vielen anderen psychischen Problemen gesprochen. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, deren täglicher Kampf sie besonders anfällig für den Griff zur Droge macht: neurodivergente Menschen, insbesondere Menschen im Autismus-Spektrum.
Für Außenstehende ist es oft unbegreiflich, warum sich jemand betäuben will. Aber wenn dein Gehirn die Welt anders verarbeitet, wenn jeder Tag ein Kampf gegen Reizüberflutung und soziale Überforderung ist, kann eine Substanz plötzlich wie die einzige Lösung erscheinen.
Was bedeutet Neurodiversität und Autismus eigentlich? 🧠
Ganz einfach gesagt: Das Gehirn von neurodivergenten Menschen ist anders „verkabelt“. Sie nehmen die Welt anders wahr.
- Neurotypisch: Die „Standard-Verkabelung“, wie sie bei der Mehrheit der Menschen vorkommt.
- Neurodivergent: Eine angeborene, neurologische Variation. Dazu gehören u.a. Autismus, ADHS, Dyskalkulie oder Tourette. Es ist keine Krankheit, sondern einfach eine andere Art des Seins.
Menschen im Autismus-Spektrum (ASS) erleben oft:
- Sensorische Über- oder Unterempfindlichkeit: Geräusche sind zu laut, Licht ist zu grell, Berührungen schmerzen, Gerüche sind unerträglich. Oder umgekehrt: Sie spüren kaum etwas.
- Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion: Nonverbale Signale (Mimik, Gestik) werden nicht intuitiv verstanden. Small Talk ist eine Qual.
- Starke Spezialinteressen und ein Bedürfnis nach Routinen und Vorhersehbarkeit.
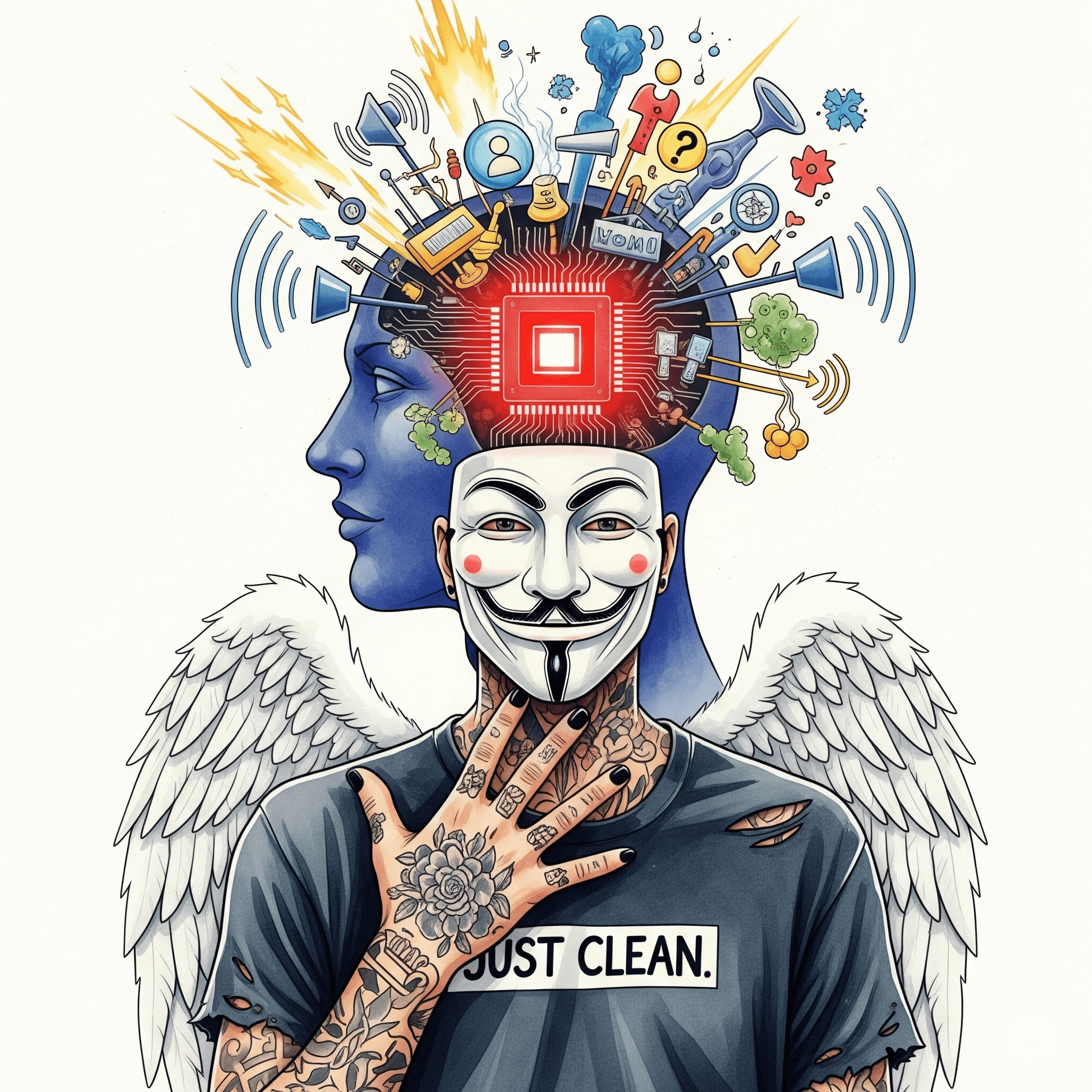
Die fatale Verbindung: Warum Autismus das Suchtrisiko erhöht
Wenn du ständig im „Überlebensmodus“ bist, weil die Welt zu laut, zu grell und zu unberechenbar ist, suchst du verzweifelt nach einem Ausweg. Hier wird die Droge zum perfekten, aber trügerischen Werkzeug der Selbstmedikation.
Die Droge als Lärmschutz-Kopfhörer für die Seele
Menschen im Autismus-Spektrum nutzen Substanzen oft aus ganz spezifischen Gründen:
- Zur Dämpfung der Reizüberflutung: Alkohol, Cannabis oder Opiate können die unerträgliche Flut an Sinneseindrücken dämpfen und eine künstliche „Ruhe“ im Kopf schaffen.
- Zur Reduzierung sozialer Ängste: Eine kleine Dosis Alkohol oder ein Beruhigungsmittel kann helfen, soziale Situationen wie Partys oder Treffen überhaupt erst „aushaltbar“ zu machen. Man fühlt sich lockerer, die Angst vor Fehlern sinkt.
- Zur Emotionsregulation: Wenn die eigenen Gefühle überwältigend und unkontrollierbar erscheinen, kann eine Substanz helfen, sie „abzuschalten“ oder zu betäuben.
- Zur „Normalisierung“: Manchmal ist es auch der Versuch, „so zu sein wie die anderen“, dazuzugehören und die eigene Andersartigkeit für einen Moment zu vergessen.
Die Sucht entsteht hier nicht aus der Suche nach einem „Kick“, sondern aus dem tiefen Bedürfnis nach Ruhe, Sicherheit und Kontrolle in einer Welt, die sich chaotisch und feindselig anfühlt.
Der Teufelskreis: Wenn die „Medizin“ zum Gift wird 🔄
Die vermeintliche Lösung wird schnell zum größten Problem:
- Die Toleranz steigt: Man braucht immer mehr von der Substanz, um die gleiche dämpfende Wirkung zu erzielen.
- Die sensorische Empfindlichkeit verschlimmert sich: Im Entzug oder bei nachlassender Wirkung kommen die Reize noch ungefilterter und brutaler zurück, was den Wunsch nach erneuter Betäubung verstärkt.
- Soziale Isolation nimmt zu: Die Sucht zerstört die wenigen stabilen sozialen Kontakte, die vielleicht noch da waren.
- Autistisches Burnout: Die ständige Anstrengung, die Sucht zu managen UND gleichzeitig mit den autistischen Herausforderungen zu kämpfen, führt zu völliger Erschöpfung.
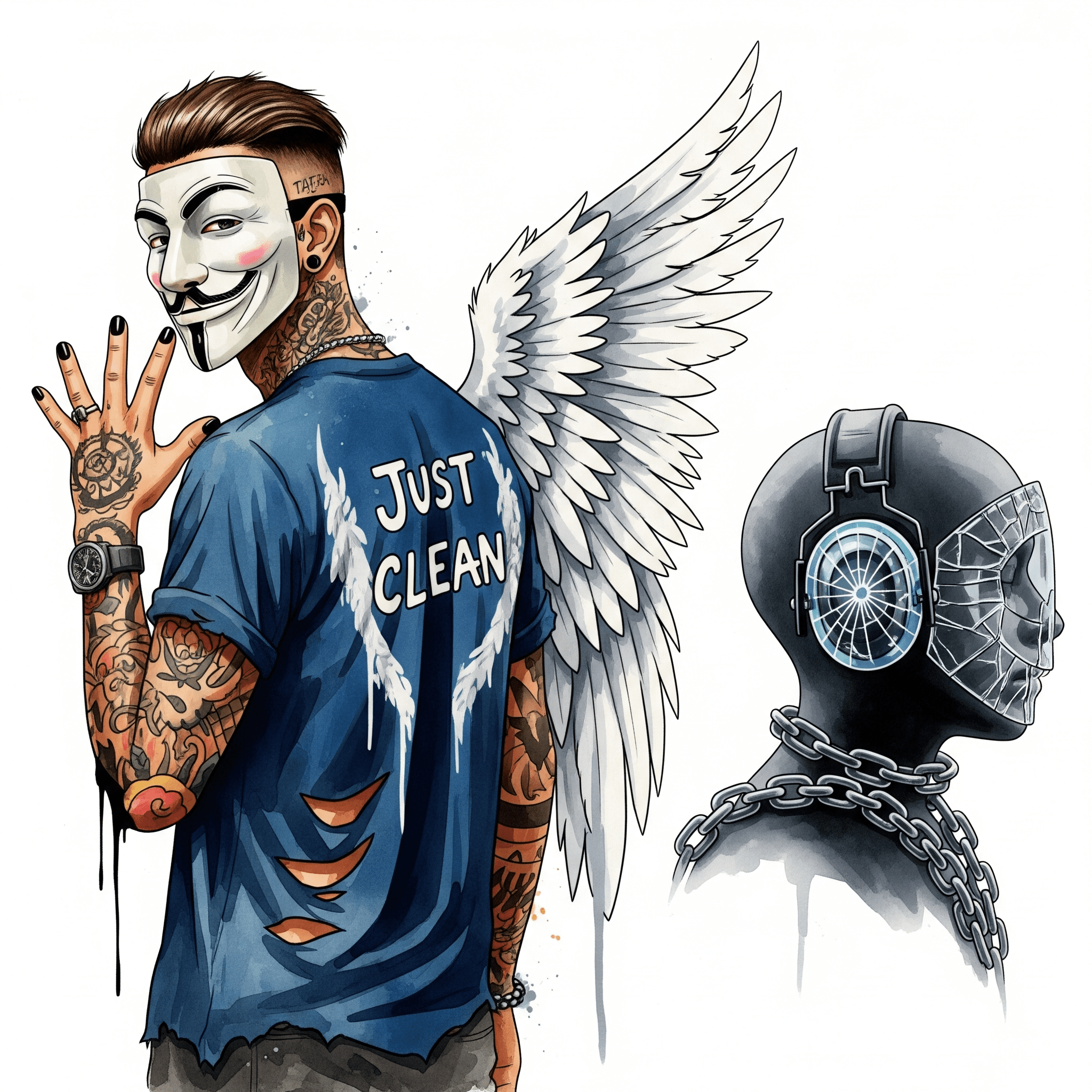
Warum Standard-Therapien oft scheitern & was wirklich hilft
Ein Mensch mit Autismus und Sucht braucht eine spezialisierte Doppeldiagnose-Therapie. Eine reine Suchttherapie, die die neurodivergenten Bedürfnisse ignoriert, ist zum Scheitern verurteilt.
- Gruppentherapie kann zur Hölle werden: Der soziale Druck, die vielen Reize und die Erwartung, nonverbale Signale zu deuten, können für autistische Menschen pure Überforderung sein.
- „Fehlende Motivation“ wird missverstanden: Wenn ein autistischer Mensch eine Therapie abbricht, liegt es oft nicht an mangelnder Motivation, sondern an der unerträglichen Überlastung durch das Therapie-Setting.
Was hilft stattdessen?
- Ein Reizarmes Umfeld: Einzeltherapie oder sehr kleine, strukturierte Gruppen.
- Klare und direkte Kommunikation: Keine Ironie, keine versteckten Botschaften.
- Fokus auf Skills: Erlernen von gesunden Strategien zur Reiz- und Emotionsregulation, die auf autistische Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Verständnis und Akzeptanz: Therapeuten, die Neurodiversität verstehen und nicht versuchen, den Autismus „wegzutherapieren“.
Fazit: Du bist nicht „falsch“, deine Bedürfnisse sind es auch nicht
Wenn du dich in diesem Text wiedererkennst, ist das Wichtigste, was du wissen musst: Du bist nicht allein und du bist nicht kaputt. Dein Bedürfnis, die Welt manchmal leiser drehen zu wollen, ist absolut verständlich.
Der Weg aus der Sucht ist für dich vielleicht ein anderer als für neurotypische Menschen, aber er ist möglich. Es geht darum, Hilfe zu finden, die DICH und deine einzigartige Wahrnehmung versteht und respektiert. Suche gezielt nach Therapeuten oder Beratungsstellen, die Erfahrung mit der Doppeldiagnose Autismus und Sucht haben.
Häufige Fragen (FAQ) zum Thema Autismus & Sucht
Sind alle neurodivergenten Menschen suchtgefährdet?
Nein, nicht alle. Aber bestimmte neurodivergente Merkmale, wie eine erhöhte sensorische Empfindlichkeit, soziale Ängste oder Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation (wie bei Autismus oder ADHS), sind anerkannte Risikofaktoren, die die Anfälligkeit für eine Suchtentwicklung erhöhen können.
Welche Drogen werden von Menschen im Autismus-Spektrum am häufigsten zur Selbstmedikation genutzt?
Das ist individuell sehr verschieden. Oft werden Substanzen bevorzugt, die eine dämpfende oder angstlösende Wirkung haben. Dazu gehören häufig Alkohol, Cannabis, Benzodiazepine oder Opiate, da sie helfen, die Reizüberflutung zu dämpfen und soziale Hemmungen abzubauen. Stimulanzien wie Amphetamine können paradoxerweise manchmal auch zur Fokussierung genutzt werden, ähnlich wie bei ADHS.
Wo finde ich spezialisierte Hilfe für die Doppeldiagnose Autismus und Sucht?
Das ist leider immer noch eine große Herausforderung. Ein guter erster Schritt sind spezialisierte Autismus-Therapiezentren oder große Suchthilfeträger (wie Caritas, Diakonie), die oft auch Erfahrung mit Komorbiditäten haben. Wichtig ist, bei der Anfrage direkt nach Erfahrung mit der Doppeldiagnose Autismus und Sucht zu fragen. Auch Selbsthilfegruppen speziell für neurodivergente Menschen können eine wertvolle Quelle für Informationen und Empfehlungen sein.



