Selbstverletzung und Suchtverhalten sind zwei ernste Probleme, die oft miteinander einhergehen. In diesem Blogbeitrag werden wir uns genauer mit beiden Themen befassen und aufzeigen, wie sie zusammenhängen.
Was ist Selbstverletzung?
Selbstverletzung ist definiert als absichtliche und wiederholte Schädigung des eigenen Körpers ohne suizidale Absicht. Sie ist eine Möglichkeit, mit emotionalem Schmerz, Stress oder überwältigenden Gefühlen umzugehen. Betroffene fügen sich selbst Verletzungen zu, um sich zu spüren, sich zu bestrafen oder um Kontrolle über ihren Körper und ihre Gefühle zu erlangen. Selbstverletzendes Verhalten tritt meist erstmals im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter auf. Doch auch bei erwachsenen Menschen kommt das Verhalten vor, oft dann, wenn vorher keine Behandlung erfolgt ist. Häufige Formen der Selbstverletzung sind:
- Schneiden: Das Ritzen der Haut mit scharfen Gegenständen wie Rasierklingen oder Messern. Betroffene schneiden sich zum Beispiel tief in die Haut oder bis ins Fleisch.
- Verbrennen: Das Verbrennen der Haut mit Zigaretten, Feuerzeugen oder anderen heißen Gegenständen.
- Kratzen: Das Aufkratzen der Haut, bis sie blutet.
- Schlagen: Sich selbst schlagen oder mit dem Kopf gegen die Wand schlagen.
- Haare ausreißen: Das Ausreißen der eigenen Haare (Trichotillomanie).
Auch Rauchen gilt als indirekte Selbstverletzung. Zwar hat man beim Rauchen nicht die direkte Absicht, sich zu verletzen, aber durch den Konsum von Zigaretten schädigt man langfristig den eigenen Körper.
Es ist wichtig zu betonen, dass Selbstverletzung in der Regel kein Suizidversuch ist. Die Betroffenen wollen sich nicht das Leben nehmen, sondern ihren emotionalen Schmerz lindern. Dennoch kann Selbstverletzung gefährlich sein und zu schweren Verletzungen führen. Manchmal fügen sich Menschen beim Selbstverletzen unbeabsichtigt so schwere Wunden zu, dass sie sterben.
Selbstverletzung und Borderline-Persönlichkeitsstörung
Selbstverletzung tritt häufig im Zusammenhang mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auf. Menschen mit einer Borderline-Störung neigen zu extremen und heftigen Stimmungs- und Gefühlsschwankungen, die sie oft als unerträglich erleben. Sie fühlen sich innerlich zerrissen und leiden unter großer innerer Anspannung. Selbstverletzungen dienen in diesem Zusammenhang der Spannungsregulierung und sind nicht mit Lebensmüdigkeit gleichzusetzen.
Zu den Symptomen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gehören:
- Heftige Gefühlsschwankungen
- Schwierigkeiten, Gefühle zu kontrollieren
- Innerer Druck und Stress
- Gefühl innerer Leere
- Instabile Beziehungen zu anderen Menschen
- Angst vor dem Verlassenwerden
Was ist Suchtverhalten?
Suchtverhalten ist gekennzeichnet durch ein zwanghaftes Verlangen nach einer Substanz oder einer bestimmten Handlung, trotz negativer Konsequenzen. Die Betroffenen verlieren die Kontrolle über ihr Verhalten und können nicht mehr aufhören, obwohl sie wissen, dass es ihnen schadet. Sucht kann sich auf verschiedene Bereiche des Lebens auswirken, wie z.B. die Gesundheit, die Beziehungen und die Arbeit.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Sucht als einen „Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge“.
Entscheidend für die Diagnose einer Sucht sind folgende Kriterien:
- Unbezwingbares Verlangen nach der Substanz
- Tendenz zur Dosissteigerung
- Psychische und/oder physische Abhängigkeit
- Schädlichkeit für den Einzelnen und/oder die Gesellschaft
- Verlust der Kontrolle über das eigene Verhalten
Arten von Suchtverhalten
Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Sucht:
- Substanzgebundene Süchte: Diese beziehen sich auf den Konsum von Substanzen wie Alkohol, Nikotin, Drogen oder Medikamenten.
- Verhaltenssüchte: Diese beziehen sich auf zwanghafte Verhaltensweisen wie Glücksspiel, Internetsucht, Kaufsucht oder Sexsucht.
Die Zunahme der Mediensucht, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, ist besorgniserregend. Auch im Bereich der Sportwetten ist eine Zunahme der Suchtproblematik zu beobachten.
Wie entsteht Sucht?
Hinter der Entstehung einer Sucht steht eine Veränderung im Gehirn. Durch den wiederholten Konsum einer Substanz oder die wiederholte Ausführung einer bestimmten Handlung wird das Belohnungszentrum im Gehirn angeregt. Das Gehirn gewöhnt sich an diese Stimulation und benötigt immer mehr davon, um das gleiche positive Gefühl zu erreichen.
Auch die körperliche Abhängigkeit spielt eine Rolle bei der Suchtentstehung. Bei einigen Suchtmitteln, wie Alkohol oder Drogen, kann der Körper physisch abhängig werden. Versucht die Person, den Konsum zu reduzieren oder aufzuhören, treten unangenehme Entzugserscheinungen auf. Um diese zu vermeiden, wird die Substanz erneut konsumiert.
Ursachen und Risikofaktoren
Sowohl Selbstverletzung als auch Suchtverhalten haben vielfältige Ursachen und Risikofaktoren. Oft spielen psychische Probleme wie Depressionen, Angststörungen oder Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Rolle. Auch traumatische Erlebnisse, Missbrauch oder soziale Isolation können zu Selbstverletzung und Suchtverhalten führen.
Weitere Risikofaktoren sind:
- Geringes Selbstwertgefühl
- Schwierigkeiten, Gefühle auszudrücken
- Mangelnde Bewältigungsstrategien
- Genetische Veranlagung
- Familiäre Vorbelastung
- Gruppenzwang
Auswirkungen von Selbstverletzung und Suchtverhalten
Selbstverletzung und Suchtverhalten haben negative Auswirkungen auf die betroffene Person und ihr Umfeld.
Auswirkungen der Selbstverletzung:
- Körperliche Schäden: Narben, Infektionen, Verletzungen.
- Psychische Belastung: Scham, Schuldgefühle, Isolation.
- Erhöhtes Suizidrisiko: Obwohl Selbstverletzung kein Suizidversuch ist, kann sie das Risiko für einen späteren Suizid erhöhen.
- Gefahr von Rückfällen: Auch wenn Betroffene professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und nicht mehr verletzen wollen, besteht die Gefahr rückfällig zu werden oft ein ganzes Leben lang.
Auswirkungen des Suchtverhaltens:
- Gesundheitliche Probleme: Organschäden, psychische Erkrankungen.
- Soziale Probleme: Beziehungsprobleme, Isolation, Jobverlust.
- Finanzielle Probleme: Verschuldung, Armut.
Co-Abhängigkeit bei Suchtverhalten
Angehörige von Suchtkranken leiden oft stark unter der Situation und rutschen nicht selten in eine Co-Abhängigkeit. Sie versuchen, dem Suchtkranken zu helfen, vernachlässigen dabei aber ihre eigenen Bedürfnisse und geraten in einen Teufelskreis.
Co-Abhängigkeit kann schwerwiegende Folgen für die Angehörigen haben:
- Psychische Belastung: Angst, Schuldgefühle, Scham, Verzweiflung
- Körperliche Beschwerden: Schlafstörungen, psychosomatische Beschwerden
- Erhöhtes Risiko für eigene Suchterkrankungen
Zusammenhang zwischen Selbstverletzung und Suchtverhalten
Selbstverletzung und Suchtverhalten treten oft gemeinsam auf. Es gibt verschiedene Gründe für diesen Zusammenhang:
Gemeinsamer Bewältigungsmechanismus
Sowohl Selbstverletzung als auch Suchtverhalten können als Strategien dienen, um mit negativen Gefühlen oder Stress umzugehen.
Ähnliche Risikofaktoren
Beide Probleme teilen viele Risikofaktoren, wie z.B. psychische Erkrankungen oder traumatische Erlebnisse.
Wechselseitige Verstärkung
Suchtmittel können die Impulskontrolle schwächen und so die Wahrscheinlichkeit für Selbstverletzung erhöhen. Umgekehrt kann Selbstverletzung zu Scham und Schuldgefühlen führen, die Betroffene versuchen, durch Suchtmittel zu betäuben.
Behandlungsmöglichkeiten
Sowohl Selbstverletzung als auch Suchtverhalten sind behandelbar. Es gibt verschiedene Therapieansätze, die Betroffenen helfen können, ihre Probleme zu überwinden.
Behandlungsmöglichkeiten bei Selbstverletzung:
- Psychotherapie: Verschiedene Therapieformen, wie z.B. die kognitive Verhaltenstherapie, können Betroffenen helfen, die Ursachen für ihre Selbstverletzung zu verstehen und alternative Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
- Skills-Training: Erlernen von Fertigkeiten zur Emotionsregulation und Stressbewältigung.
- Medikamente: In manchen Fällen können Medikamente wie Antidepressiva eingesetzt werden, um zugrunde liegende psychische Erkrankungen zu behandeln oder wenn der Zustand durch Depressionen oder Angstzustände ausgelöst wird.
Behandlungsmöglichkeiten bei Suchtverhalten:
- Entzugstherapie: Unterstützung beim Entzug von Suchtmitteln. Die Entzugstherapie hilft auch dabei, die Ursachen der Sucht zu identifizieren und alternative Verhaltensweisen zu entwickeln.
- Psychotherapie: Verhaltenstherapie, Gruppentherapie, Einzeltherapie.
- Selbsthilfegruppen: Austausch mit anderen Betroffenen.
- Medikamente: In manchen Fällen können Medikamente eingesetzt werden, um den Suchtdruck zu reduzieren oder Entzugserscheinungen zu lindern.
Prävention und Hilfe
Präventionsmaßnahmen sind wichtig, um Selbstverletzung und Suchtverhalten vorzubeugen. Dazu gehören:
- Frühzeitige Aufklärung: Information über die Risiken und Folgen von Selbstverletzung und Sucht.
- Förderung von emotionaler Kompetenz: Stärkung des Selbstwertgefühls, Förderung von Bewältigungsstrategien.
- Schaffung eines unterstützenden Umfelds: Offene Kommunikation, soziale Unterstützung.
Trigger im Internet
Gerade im Internet, auf Plattformen wie YouTube oder Instagram, werden häufig Bilder oder Videos geteilt, die Selbstverletzung verharmlosen oder sogar verherrlichen. Solche Inhalte können für Betroffene gefährlich sein, da sie Erinnerungen an negative Gefühle und Erlebnisse auslösen und den Drang zur Selbstverletzung verstärken können. Diese Wirkung bezeichnet man als Trigger.
Wie kann man Betroffenen helfen?
- Ernst nehmen: Selbstverletzung und Suchtverhalten sind ernste Probleme, die nicht bagatellisiert werden sollten.
- Zuhören: Betroffenen Raum geben, über ihre Probleme zu sprechen.
- Unterstützen: Hilfe bei der Suche nach professioneller Unterstützung anbieten.
- Nicht verurteilen: Verständnis und Empathie zeigen.
- Auf eigene Grenzen achten: Angehörige sollten sich nicht überfordern und auch auf ihre eigene Gesundheit achten.
Skills-Training
Im Skills-Training lernen Betroffene Fertigkeiten, um mit schwierigen Gefühlen und Situationen umzugehen, ohne sich selbst zu verletzen. Skills können zum Beispiel sein:
- Sich ablenken: Sport treiben, Musik hören, etwas Kreatives tun
- Intensive Sinnesreize: Kalt duschen, Eiswürfel lutschen, scharfe Bonbons essen
- Gefühle ausdrücken: Schreiben, Malen, Musik machen
- Soziale Kontakte: Freunde anrufen, sich mit jemandem treffen
Fazit
Selbstverletzung und Suchtverhalten sind komplexe Probleme mit vielfältigen Ursachen und Auswirkungen. Es ist wichtig, Betroffene ernst zu nehmen und ihnen Hilfe anzubieten. Mit professioneller Unterstützung können sie lernen, ihre Probleme zu bewältigen und ein gesundes Leben zu führen.
Zusätzliche Ressourcen
Hier findest Du weitere Informationen und Hilfe zum Thema Selbstverletzung und Suchtverhalten:
- Nummer gegen Kummer: Telefonische Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 116 111
- Telefonseelsorge: Anonyme und kostenlose Beratung, Tel. 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS): www.dhs.de
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): www.bzga.de





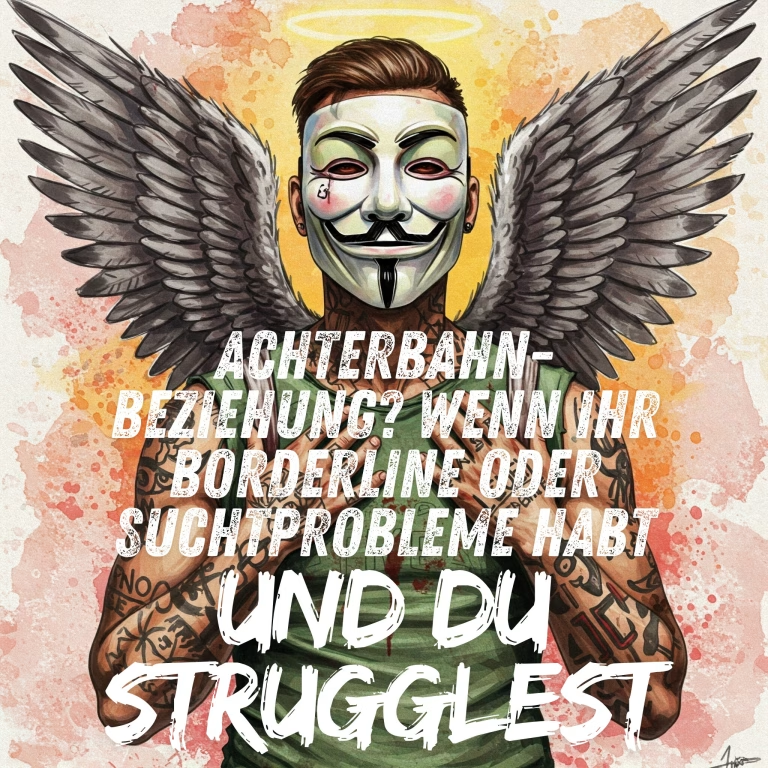

Leave a Comment