Drogenkonsum ist ein weit verbreitetes Phänomen, das Menschen jeden Alters und jeder sozialen Schicht betrifft. Oftmals wird Drogenkonsum mit Problemen im sozialen Umfeld, in der Familie oder im Beruf in Verbindung gebracht. Doch was passiert, wenn Drogenkonsum auf eine bereits bestehende psychische Erkrankung trifft, wie beispielsweise eine Persönlichkeitsstörung? Dieser Artikel beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Persönlichkeitsstörungen und Drogenkonsum und gibt Einblicke in die Ursachen, Folgen und Behandlungsmöglichkeiten.
Was sind Persönlichkeitsstörungen?
Persönlichkeitsstörungen sind psychische Erkrankungen, die durch tiefgreifende und unflexible Muster im Denken, Fühlen und Verhalten gekennzeichnet sind. Diese Muster weichen deutlich von den Erwartungen der jeweiligen Kultur ab und führen in vielen Lebensbereichen zu Problemen. Sie manifestieren sich in mindestens zwei der folgenden Bereiche: Kognition (Wahrnehmung und Interpretation von sich selbst, anderen und Ereignissen), Affektivität (emotionale Reaktionen), Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen und Impulskontrolle. Betroffene haben oft Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren, stabile Beziehungen aufzubauen und mit Stress umzugehen. Ein wichtiger Aspekt von Persönlichkeitsstörungen ist, dass Betroffene oft kein klares oder stabiles Selbstbild haben. Ihr Selbstbild und ihre Werte können sich je nach Situation und den Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, verändern.
Neben den „klassischen“ Persönlichkeitsstörungen gibt es auch andauernde Persönlichkeitsveränderungen, die ohne das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung auftreten können. Diese können durch besonders starke Belastungen oder schwere psychiatrische Erkrankungen entstehen. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Typ-A-Verhalten, das durch starken Ehrgeiz, das Streben nach Erfolg, Ungeduld, Konkurrenzdenken und das Gefühl, unter Druck zu stehen, gekennzeichnet ist.
Es gibt verschiedene Arten von Persönlichkeitsstörungen, die sich in drei Gruppen (Cluster) einteilen lassen:
| Persönlichkeitsstörung | Cluster | Merkmale | Probleme |
|---|---|---|---|
| Paranoide Persönlichkeitsstörung | A | Misstrauen, Argwohn, Überempfindlichkeit | Schwierigkeiten im Umgang mit anderen, Konflikte |
| Schizoide Persönlichkeitsstörung | A | Desinteresse an sozialen Beziehungen, emotionale Distanziertheit | Soziale Isolation, Probleme in Beziehungen |
| Schizotypische Persönlichkeitsstörung | A | Ungewöhnliche Denk- und Verhaltensweisen, exzentrisches Verhalten, magisches Denken | Soziale Ängste, Probleme in Beziehungen |
| Antisoziale Persönlichkeitsstörung | B | Missachtung der Rechte anderer, Impulsivität, Verantwortungslosigkeit, mangelnde Reue | Konflikte mit dem Gesetz, gestörte Beziehungen |
| Borderline-Persönlichkeitsstörung | B | Instabile Beziehungen, starke Stimmungsschwankungen, Impulsivität, gestörtes Selbstbild | Selbstverletzung, Suizidalität, intensive aber instabile Beziehungen |
| Histrionische Persönlichkeitsstörung | B | Übermäßiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, theatralisches Verhalten | Oberflächliche Beziehungen, emotionale Instabilität |
| Narzisstische Persönlichkeitsstörung | B | Übersteigertes Selbstwertgefühl, Bedürfnis nach Bewunderung, mangelnde Empathie | Probleme in Beziehungen, Konflikte im Beruf |
| Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung | C | Angst und Unsicherheit in sozialen Situationen, Vermeidung von sozialen Kontakten | Soziale Isolation, Einsamkeit |
| Dependente Persönlichkeitsstörung | C | Starkes Bedürfnis nach Fürsorge, Angst vor dem Alleinsein | Abhängigkeit von anderen, Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen |
| Zwanghafte Persönlichkeitsstörung | C | Perfektionismus, Ordnungsliebe, Kontrollbedürfnis | Starre, unflexible Verhaltensweisen, Probleme in Beziehungen |
Drogen und ihre Auswirkungen
Drogen sind Substanzen, die die Psyche beeinflussen und so das Denken, Fühlen und die Wahrnehmung verändern. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Drogen, die unterschiedliche Wirkungen auf Körper und Psyche haben. Drogen lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterteilen:
Einteilung nach dem Gesetz:
Einteilung nach Wirkung:
Drogen können beispielsweise beruhigend, angstlösend, stimmungsaufhellend, schlaffördernd, anregend, schmerzlindernd sein oder auch Halluzinationen erzeugen. Oft treten mehrere Wirkungen gleichzeitig auf.
Einteilung nach Stoffklassen:
Diese Unterscheidung beruht auf den chemischen Eigenschaften der Drogen.
Beispiele für Drogen und ihre Auswirkungen:
- Stimulanzien (z.B. Kokain, Amphetamine): Führen zu Euphorie, erhöhter Energie und vermindertem Schlafbedürfnis. Langfristig können sie Angstzustände, Psychosen und Herz-Kreislauf-Probleme verursachen.
- Sedativa (z.B. Alkohol, Benzodiazepine): Wirken beruhigend und angstlösend, können aber auch zu Abhängigkeit, Gedächtnisproblemen und Atemdepression führen.
- Halluzinogene (z.B. LSD, Psilocybin): Verändern die Wahrnehmung und lösen Halluzinationen aus. Sie können Psychosen und Flashbacks verursachen.
- Opioide (z.B. Heroin, Morphin): Wirken schmerzlindernd und euphorisierend, führen aber schnell zu Abhängigkeit und können bei Überdosierung zum Tod führen.
- Cannabinoide (z.B. Cannabis): Können entspannend, angstlösend und euphorisierend wirken, aber auch zu Konzentrationsstörungen, Psychosen und Abhängigkeit führen. Cannabis hat jedoch auch potenziell positive therapeutische Wirkungen, die beispielsweise bei Angststörungen oder chronischen Schmerzen eingesetzt werden können. Diese Wirkungen können im Einzelfall aber auch als unerwünschte Wirkung betrachtet werden.
Allen Rauschgiften ist gemeinsam, dass sie zu Veränderungen der Hirnstrukturen führen. Durch die dauerhafte Aktivierung des Belohnungssystems im Gehirn kommt es zu einer Art Reizüberflutung. Dadurch wird die Aktivierungsschwelle für positive Reize enorm angehoben, was bedeutet, dass „normale“ Aktivitäten und Erfahrungen nicht mehr die gleiche Befriedigung vermitteln.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Wirkung von Drogen je nach Substanz, Menge, Persönlichkeit und Genetik des Konsumenten stark variieren kann.
Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsstörungen und Drogenkonsum
Studien zeigen, dass Menschen mit Persönlichkeitsstörungen ein erhöhtes Risiko haben, Drogen zu konsumieren. Dies hat verschiedene Gründe:
Selbstmedikation:
Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben oft Schwierigkeiten, mit ihren Emotionen umzugehen und negative Gefühle wie Angst, Wut oder Leere zu regulieren. Drogen können diese Gefühle kurzfristig unterdrücken und ein Gefühl von Kontrolle und Wohlbefinden vermitteln. So neigen Menschen mit ängstlich-vermeidender Persönlichkeitsstörung eher zu beruhigenden Substanzen wie Alkohol oder Benzodiazepinen, während Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung eher zu Stimulanzien wie Kokain oder Amphetaminen greifen.
Risikoverhalten:
Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Impulsivität, Risikobereitschaft und die Suche nach neuen Erfahrungen können den Drogenkonsum begünstigen.
Verstärkung der Symptome:
Drogenkonsum kann die Symptome einer Persönlichkeitsstörung verstärken und den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen. So kann Cannabis bei Menschen mit schizotyper Persönlichkeitsstörung psychotische Symptome auslösen, während Alkohol bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung die Impulskontrolle weiter verschlechtern kann. Der Konsum von Alkohol und Drogen kann die Identitätsentwicklung von Jugendlichen negativ beeinflussen, insbesondere in Bezug auf Kohärenz und Kontinuität im Selbsterleben. Jugendliche mit Substanzmissbrauch verfehlen häufig altersadäquate Entwicklungsaufgaben und haben Schwierigkeiten, die Schule abzuschließen, eine Arbeit zu finden oder eine funktionierende Partnerschaft zu führen. Sie neigen dazu, diese Entwicklungsaufgaben zu „überspringen“, was zu Versagen und Scheitern führen kann, welches wiederum den Drogenkonsum rechtfertigt.
Wechselseitige Bedingung:
Sucht und Persönlichkeitsstörungen können sich gegenseitig bedingen. Drogenkonsum kann zu Persönlichkeitsveränderungen führen, und Menschen mit Persönlichkeitsstörungen können Drogen konsumieren, um ihre Symptome zu lindern. Die Diagnose von zusammen auftretenden Störungen wie Sucht und Persönlichkeitsstörungen ist schwierig, da die beiden Störungen viele Symptome gemeinsam haben, wie z.B. selbstzerstörerisches Verhalten und schlechtes Urteilsvermögen.
Gesellschaftliche Reaktion:
Die „institutionell organisierte Form der gesellschaftlichen Reaktion“ auf Drogenkonsum kann sehr unterschiedlich aussehen. Sie reicht von Behandlung und Betreuung über Bestrafung bis hin zum Ignorieren oder Tolerieren des Drogenkonsums. Diese Reaktionen erfüllen verschiedene gesellschaftliche Funktionen, wie z.B. den Schutz der Bevölkerung, die Resozialisierung von Süchtigen oder die Verhinderung von Kriminalität.
Risikofaktoren
Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen mit Persönlichkeitsstörungen Drogen konsumieren:
- Genetische Veranlagung: Studien zeigen, dass Suchterkrankungen familiär gehäuft auftreten.
- Traumatische Erlebnisse: Körperlicher oder sexueller Missbrauch in der Kindheit erhöht das Risiko für Persönlichkeitsstörungen und Drogenkonsum.
- Ungünstige soziale Bedingungen: Armut, soziale Isolation und mangelnde soziale Unterstützung können den Drogenkonsum begünstigen.
- Psychische Komorbidität: Das gleichzeitige Vorliegen anderer psychischer Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen erhöht das Risiko für Drogenkonsum.
- Körperliche Gewöhnung: Der Körper gewöhnt sich an die regelmäßige Drogenzufuhr und reagiert mit einem beschleunigten Abbau des Stoffes oder speziellen Anpassungsvorgängen im Nervensystem. Um die gleiche Wirkung zu erzielen, muss die Droge in immer höheren Mengen konsumiert werden.
- Kognitive Abwehrmechanismen: Kognitive Verzerrungen und Abwehrmechanismen wie Kontrollillusion, Verleugnung und Bagatellisierung können den Drogenkonsum aufrechterhalten. Betroffene verleugnen oder bagatellisieren die negativen Folgen ihres Konsums und halten an der Illusion fest, ihren Konsum kontrollieren zu können.
- Einfluss von Peers und Familie: Der Kontakt zu konsumierenden Peers und die familiäre Situation spielen eine wichtige Rolle. Jugendliche, deren Freunde Drogen konsumieren, haben ein erhöhtes Risiko, selbst mit Drogen zu experimentieren. Auch eine familiäre Vorbelastung mit Sucht oder psychischen Erkrankungen kann das Risiko erhöhen.
Es ist wichtig zu betonen, dass das Risiko für Drogenkonsum und die Entwicklung von Problemen durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren auf der seelischen, körperlichen und sozialen Ebene beeinflusst wird.
Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlung von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen und Drogenkonsum ist komplex und erfordert einen individuellen Therapieplan. In der Regel kombiniert man Psychotherapie und medikamentöse Behandlung. Es ist entscheidend, beide Störungen gleichzeitig zu behandeln, um einen Rückfall zu verhindern.
Psychotherapie:
- Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT): Speziell für Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, fokussiert sich auf Emotionsregulation, Stresstoleranz und zwischenmenschliche Fertigkeiten.
- Schematherapie: Hilft Betroffenen, negative Denkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen und zu verändern, die in der Kindheit entstanden sind.
- Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT): Fördert die Fähigkeit, die eigenen Gedanken und Gefühle sowie die anderer Menschen zu verstehen.
- Kognitive Verhaltenstherapie: Hilft Betroffenen, ungünstige Denkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen und zu verändern.
In der Therapie ist es wichtig, die Identitätsfindung des Betroffenen zu berücksichtigen. Drogenkonsum kann die Identitätsentwicklung beeinträchtigen, und die Therapie sollte Betroffenen helfen, ein stabiles Selbstbild zu entwickeln und ihre Identität zu finden.
Medikamentöse Behandlung:
- Antidepressiva: Können bei Depressionen und Angstzuständen eingesetzt werden.
- Stimmungsstabilisierer: Helfen, Stimmungsschwankungen zu reduzieren. Beispiele hierfür sind Lithium oder Lamotrigin.
- Antipsychotika: Können bei psychotischen Symptomen eingesetzt werden. Bei Dissoziationsstörungen, wie z.B. Gefühlen von Abwesenheit oder Leere, können niedrig dosierte Antipsychotika eingesetzt werden.
Fazit
Persönlichkeitsstörungen und Drogenkonsum sind eng miteinander verbunden. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben ein erhöhtes Risiko, Drogen zu konsumieren, um negative Gefühle zu regulieren oder bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Drogenkonsum kann die Symptome der Persönlichkeitsstörung verstärken und den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen. Eine frühzeitige Diagnose und eine individuelle Therapie sind entscheidend, um Betroffenen zu helfen, ein stabiles und erfülltes Leben zu führen.
Die Entstehung von Sucht ist ein multifaktorieller Prozess, bei dem sowohl biologische und psychologische als auch soziale Faktoren eine Rolle spielen. Persönlichkeitsmerkmale, die Drogenwirkung und kognitive Prozesse stehen in einer komplexen Wechselwirkung. Ein individueller Therapieansatz, der die spezifischen Bedürfnisse und Probleme des Betroffenen berücksichtigt, ist daher unerlässlich.

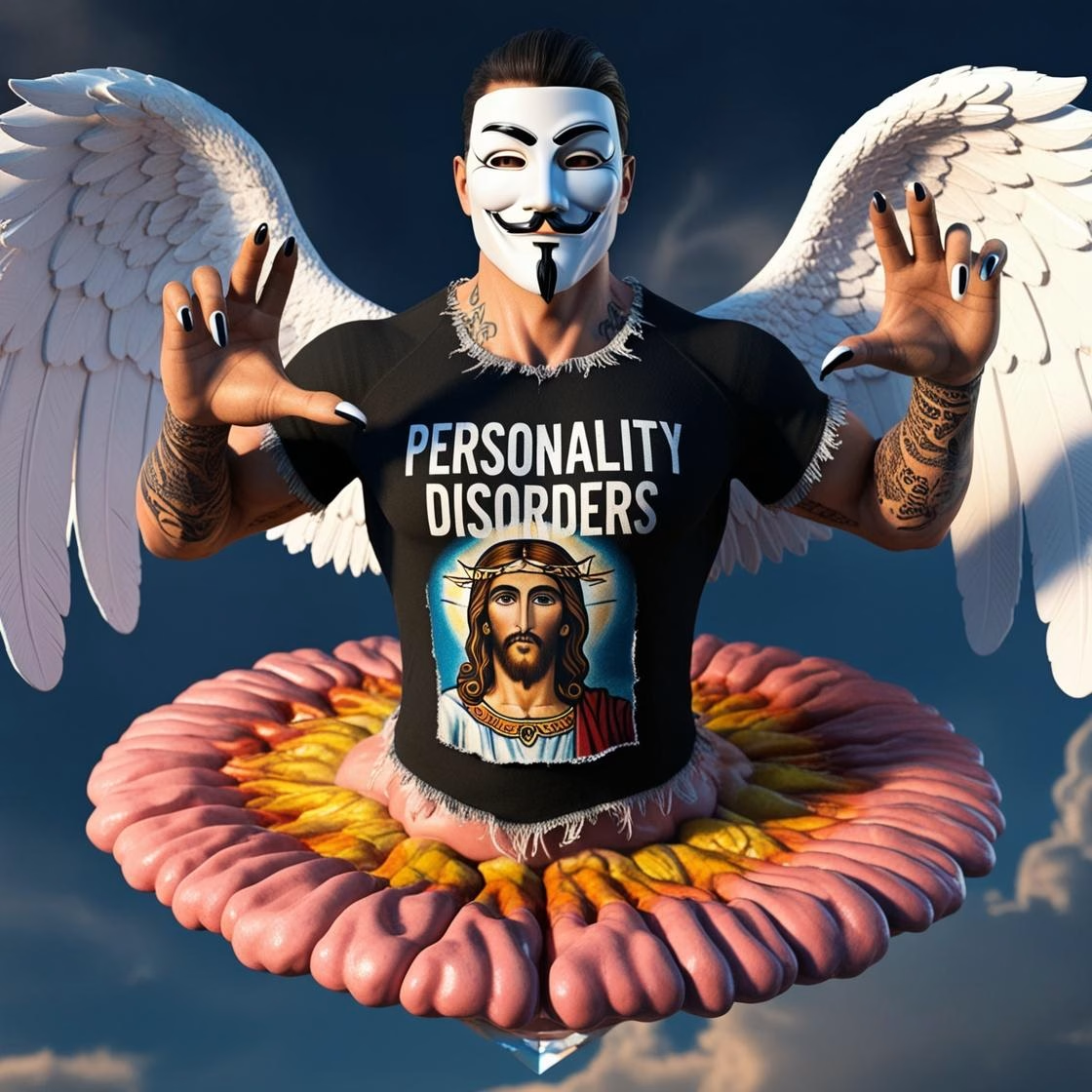


Leave a Comment