Die Suchtprävention hat sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt. Weg von allgemeinen Warnungen, hin zu differenzierten Ansätzen, die auf die Bedürfnisse spezifischer Gruppen zugeschnitten sind. Einer dieser Ansätze ist die indizierte Prävention. Aber was genau verbirgt sich dahinter, für wen ist sie geeignet und wie unterscheidet sie sich von anderen Präventionsformen?
Was ist indizierte Prävention?
Im Gegensatz zur universellen Prävention (die sich an die gesamte Bevölkerung richtet) und der selektiven Prävention (die sich an Gruppen mit erhöhtem Risiko richtet) konzentriert sich die indizierte Prävention auf Personen, die bereits erste Anzeichen oder Symptome einer Suchtproblematik zeigen, aber noch keine diagnostizierbare Suchterkrankung entwickelt haben.
Stell dir einen Trichter vor:
- Universelle Prävention: Die breite Öffnung des Trichters – sie erreicht jeden.
- Selektive Prävention: Der mittlere Teil des Trichters – sie erreicht Personen mit bestimmten Risikofaktoren.
- Indizierte Prävention: Der engste Teil des Trichters – sie erreicht Personen mit ersten Anzeichen einer Problematik.
Die Zielgruppe: Wer profitiert von indizierter Prävention?
Indizierte Prävention richtet sich an Menschen, die sich in einer Grauzone befinden. Sie zeigen möglicherweise:
- Experimentellen oder gelegentlichen Substanzkonsum: z.B. gelegentliches Komasaufen am Wochenende, regelmäßiger Cannabiskonsum nach der Arbeit.
- Problematisches Verhalten in Bezug auf Glücksspiel, Internetnutzung oder andere Verhaltenssüchte: z.B. zunehmende Spielzeiten, Vernachlässigung von Pflichten, erste finanzielle Schwierigkeiten.
- Frühe psychische oder soziale Probleme, die mit Substanzkonsum oder Verhaltenssüchten in Verbindung stehen: z.B. Isolation, Stimmungsschwankungen, Konflikte in Beziehungen.
- Eine familiäre Vorbelastung mit Suchterkrankungen: Dies kann ein zusätzlicher Risikofaktor sein, auch wenn noch kein eigenes problematisches Verhalten vorliegt.
Wichtig: Es geht nicht darum, diese Personen zu stigmatisieren oder zu verurteilen. Vielmehr soll frühzeitig Unterstützung angeboten werden, um eine manifeste Suchterkrankung zu verhindern.
Ziele der indizierten Prävention:
- Früherkennung: Identifizierung von Risikoverhalten und ersten Anzeichen einer Suchtentwicklung.
- Schadensbegrenzung: Reduzierung der negativen Folgen des Substanzkonsums oder problematischen Verhaltens.
- Verhaltensänderung: Förderung von gesundheitsbewussten Entscheidungen und Verhaltensweisen.
- Rückfallprävention: Bei Personen, die bereits eine Behandlung abgeschlossen haben, kann indizierte Prävention helfen, einen Rückfall zu verhindern.
- Vermeidung einer Chronifizierung: Das Hauptziel ist, den Übergang von riskantem Verhalten zu einer ausgewachsenen Suchterkrankung zu verhindern.
Methoden und Ansätze der indizierten Prävention:
Indizierte Prävention ist vielfältig und nutzt verschiedene Methoden, die individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten werden:
- Screening und Frühintervention:
- Kurzfragebögen: z.B. AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test).
- Motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing): Eine klientenzentrierte Methode, die darauf abzielt, die intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung zu stärken.
- Frühinterventionsprogramme: siehe unten.
- Beratung und Coaching:
- Einzel- oder Gruppensitzungen: Bieten Raum für Reflexion, Wissensvermittlung und Entwicklung von Bewältigungsstrategien.
- Online-Beratung: Niedrigschwelliger Zugang zu professioneller Hilfe.
- Verhaltenstherapeutische Ansätze:
- Kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Hilft, dysfunktionale Gedanken und Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern.
- Rückfallpräventionstraining: Vermittelt Strategien zur Vermeidung von Risikosituationen und zum Umgang mit Suchtdruck.
- Sozialpädagogische Maßnahmen:
- Aufsuchende Arbeit (Streetwork): Erreicht Menschen in ihrem Lebensumfeld.
- Schulbasierte Programme: Können sowohl selektive als auch indizierte Elemente enthalten.
- Pharmakologische Unterstützung
- In manchen Fällen kann, nach ausführlicher ärztlicher Abwägung, eine kurzzeitige medikamentöse Unterstützung in Frage kommen, um z.B. Entzugssymptome zu lindern, oder das Craving (starkes Verlangen) zu reduzieren. Dies ist aber immer nur ein Teil eines umfassenden Ansatzes.
Konkrete Beispiele für erfolgreiche Programme
Um die Vielfalt der indizierten Prävention zu veranschaulichen, hier einige Beispiele für Programme, die in Deutschland und international etabliert sind:
1. Alkohol:
- „FreD“ (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten):
- Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene, die erstmalig durch Alkoholkonsum (oder andere illegale Drogen) polizeilich auffällig geworden sind.
- Methode: 8-stündige Kurse in Kleingruppen. Motivierende Gesprächsführung, Wissensvermittlung, Reflexion, Entwicklung von Risikokompetenz.
- Erfolge: Reduktion des riskanten Konsums, Zunahme der Veränderungsbereitschaft.
- „A-CHECK“ (Alkohol-Check):
- Zielgruppe: Junge Erwachsene (16–25 Jahre) mit riskantem Alkoholkonsum.
- Methode: Online-basiert mit Selbsttest, individuellem Feedback, Informationen, optionale Online-Beratung.
- Erfolge: Reduktion der Trinkmenge und der Häufigkeit von Rauschtrinken.
2. Cannabis:
- „Realize it“:
- Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene (14-21 Jahre) mit regelmäßigem Cannabiskonsum und ersten negativen Folgen.
- Methode: Einzelgespräche oder Kleingruppenkurse. KVT, Motivierende Gesprächsführung, Ausstiegskompetenzen, Rückfallprävention.
- Erfolge: Reduktion des Cannabiskonsums, Verbesserung der psychosozialen Situation.
- „CANSAS“ (Cannabis-Ausstiegsprogramm):
- Zielgruppe: Für Erwachsene, die Ihren Cannabiskonsum reduzieren/beenden möchten.
- Methode: Manualisiertes Programm, oft in Gruppen, KVT und Motivational Interviewing.
- Erfolge: Gute Ergebnisse hinsichtlich Konsumreduktion und Abstinenz. 3. Glücksspiel:
- „Check dein Spiel“:
- Zielgruppe: Menschen mit problematischem Glücksspielverhalten und Angehörige.
- Methode: Online-Informationsportal, Selbsttests, Online-Beratung.
- Erfolge: Sehr gute Reichweite und niedrigschwelliger Zugang.
- Kurzintervention Glücksspiel:
- Zielgruppe: Personen mit riskantem/problematischen Glücksspielverhalten in Beratungsstellen.
- Methode: Kurzberatung (1-5 Sitzungen) auf Basis Motivierender Gesprächsführung und KVT.
- Erfolge: Auch kurze Interventionen können wirksam sein.
4. Illegale Drogen (allgemein):
- „MOVE“ (Motivational Enhancement)
- Zielgruppe: MOVE ist ein flexibel einsetzbarer Ansatz (Schulen, Jugendhilfe, etc.)
- Methode: Motivierende Kurzintervention, Fokus auf intrinsische Motivation.
- Erfolge: Wirksam bei verschiedenen Substanzmitteln.
- „Trampolin“: (eigentlich selektiv, aber mit indizierten Elementen)
- Zielgruppe: Kinder aus suchtbelasteten Familien (8-12 Jahre).
- Methode: Gruppenprogramm zur Stärkung der Resilienz, Wissensvermittlung, Bewältigungsstrategien.
- Erfolge: Verbesserung des Selbstwertgefühls, der sozialen Kompetenz, Umgang mit Belastungen.
Wichtiger Hinweis:
- Verfügbarkeit: Nicht alle Programme sind überall verfügbar.
- Qualität: Auf wissensbasierte und zertifizierte Angebote achten.
- Individuelle Passung: Professionelle Beratung hilft bei der Auswahl.
- Forschung: Die Forschung ist dynamisch, neue Programme entstehen.
Balanx Berlin: Ein Beispiel für integrierte Suchthilfe und indizierte Prävention
Balanx Berlin ist ein anerkannter Träger der Suchthilfe in Berlin, der ein breites Spektrum an Angeboten vorhält – von ambulanter und stationärer Rehabilitation bis hin zu Prävention und Frühintervention. Der Verein verfolgt einen integrierten Ansatz. Für die indizierte Prävention sind insbesondere folgende Aspekte relevant:
1. Ambulante Angebote und Frühintervention:
- Suchtberatungsstelle: Beratung für Menschen mit unterschiedlichen Suchtproblematiken in Berlin-Neuköln. Frühintervention bei beginnendem problematischen Konsum.
- Motivierende Gesprächsführung: Die Berater*innen sind in Motivierender Gesprächsführung (Motivational Interviewing) geschult.
- Individuelle Beratung und Therapieplanung: Klärung der Situation im Erstgespräch, gemeinsame Entscheidung über weitere Schritte.
- Spezifische Angebote: Gruppenangebote wie Stressbewältigungstraining, als Ergänzung zur Suchtberatung
- Online-Beratung: Erleichterter Zugang zu Hilfe.
2. Vernetzung und Kooperation:
- Balanx ist gut in das Berliner Suchthilfesystem integriert. Schnelle Vermittlung in andere Angebote möglich.
- Enge Zusammenarbeit zwischen Prävention, Beratung und Therapie ermöglicht fließende Übergänge.
3. Haltung und Ansatz (indirekte Aspekte):
- Ressourcenorientierung: Balanx betont die Stärken der Klient*innen.
- Akzeptierende Haltung: Wertschätzende Haltung gegenüber den Klient*innen, wichtig zur Vermeidung von Stigmatisierung.
- Transparenz und Partizipation Einbezug der Klienten.
Wie Balanx konkret mit indizierter Prävention arbeitet (Interpretation):
Obwohl Balanx den Begriff nicht explizit verwendet, sprechen viele Angebote genau diese Zielgruppe an:
- Früherkennung durch Beratung: Die Beratungsstelle ist oft die erste Anlaufstelle.
- Niedrigschwelliger Zugang: Offene Sprechstunde und Online-Beratung.
- Individuelle Angebote: Beratung und Therapieplanung sind individuell.
- Angebote für Angehörige: Wichtige Rolle bei der Motivation zur Inanspruchnahme.
Zusammenfassend: Balanx Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, wie indizierte Prävention im Rahmen eines umfassenden Suchthilfeangebots umgesetzt werden kann.
Wichtiger Hinweis: Diese Beschreibung basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen. Für verbindliche Auskünfte direkt Kontakt mit Balanx aufnehmen.
Abgrenzung zu anderen Präventionsformen und zur Behandlung:
- Universelle Prävention: Richtet sich an die Allgemeinheit (z.B. Aufklärungskampagnen).
- Selektive Prävention: Richtet sich an Risikogruppen (z.B. Kinder suchtkranker Eltern).
- Indizierte Prävention: Richtet sich an Personen mit ersten Anzeichen einer Problematik.
- Behandlung/Therapie: Richtet sich an Personen mit einer diagnostizierten Suchterkrankung.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Grenzen zwischen diesen Bereichen fließend sein können. Indizierte Prävention kann als Brücke zwischen Prävention und Behandlung dienen.
Herausforderungen und Kritik:
- Stigmatisierung: Die Gefahr besteht, dass Personen durch die Einordnung in eine „Risikogruppe“ stigmatisiert werden.
- Fehlende Ressourcen: Oft fehlen die finanziellen und personellen Mittel für eine flächendeckende Umsetzung.
- Erreichbarkeit der Zielgruppe: Es ist nicht immer einfach, die Personen zu erreichen.
- Evidenzbasierung: Es bedarf weiterer Forschung zur Wirksamkeit.
- „Falsch-Positive“: Risiko der falschen Einstufung als Risikoperson.
Fazit und Ausblick:
Indizierte Prävention ist ein wichtiger Baustein in einem umfassenden System der Suchthilfe. Sie bietet die Chance, frühzeitig einzugreifen und die Entwicklung schwerwiegender Suchterkrankungen zu verhindern. Trotz der Herausforderungen ist es entscheidend, in diesen Bereich zu investieren, um:
- Leid zu mindern: Für Betroffene und ihre Angehörigen.
- Kosten zu senken: Für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft.
- Eine gesündere Zukunft zu gestalten: Für uns alle.
Die Weiterentwicklung und Implementierung evidenzbasierter Programme, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Vernetzung der verschiedenen Akteure sind entscheidende Schritte.


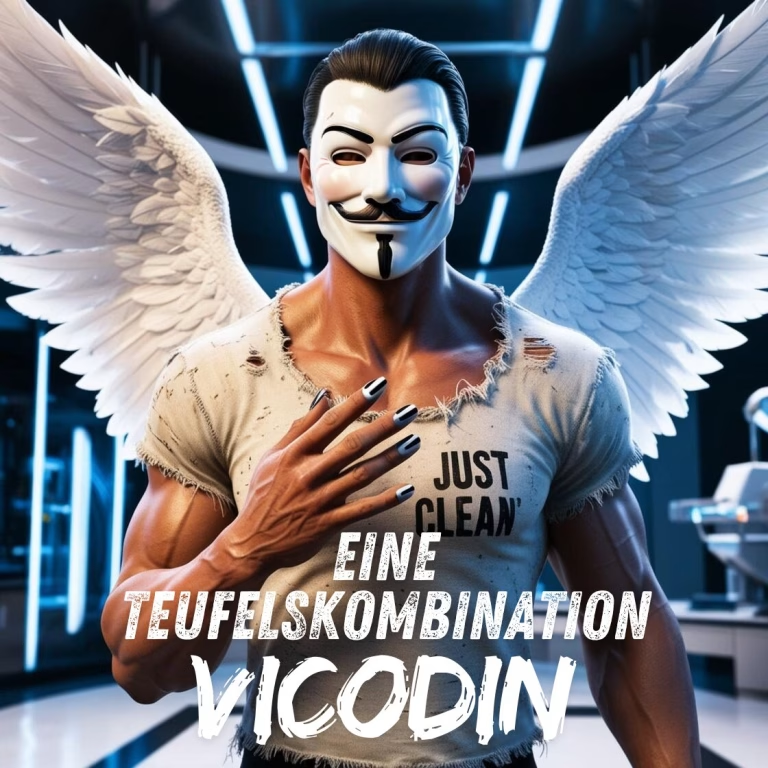

Leave a Comment