
Einleitung
Drogen- und Alkoholabhängigkeit sind zerstörerische Krankheiten, die nicht nur körperliche und soziale Schäden verursachen. Sie erhöhen auch das Risiko für Suizid drastisch. Dieser Beitrag beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Sucht und Suizidalität, schildert fiktive Erfahrungsberichte, um das Thema greifbarer zu machen, zeigt Warnsignale auf und stellt umfangreiche Hilfsangebote vor.
Die unsichtbare Verbindung: Warum Sucht das Suizidrisiko erhöht:
Die Verbindung zwischen Substanzmissbrauch und Suizid ist vielschichtig. Mehrere Faktoren spielen zusammen:
1. Psychische Erkrankungen als Wegbereiter und Verstärker:
- Depressionen und Angststörungen: Sucht und psychische Erkrankungen treten oft gemeinsam auf. Alkohol und Drogen können als „Selbstmedikation“ dienen, verstärken aber langfristig depressive Symptome oder lösen sie aus. Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS): Traumatische Erlebnisse werden oft mit Substanzen betäubt. PTBS selbst erhöht das Suizidrisiko. Bipolare Störung: Manische Phasen fördern riskanten Konsum, depressive Phasen das Suizidrisiko. Persönlichkeitsstörungen: Borderline– oder dissoziale Persönlichkeitsstörungen erhöhen die Anfälligkeit für Sucht und Suizid.
2. Das Gehirn im Ausnahmezustand: Neurobiologische Veränderungen:
- Belohnungssystem: Drogen und Alkohol manipulieren das Belohnungssystem. Chronischer Konsum stumpft ab, reduziert Freude und erhöht die Anfälligkeit für negative Gefühle.
- Stressreaktion: Der Körper wird chronisch überlastet, was die Fähigkeit zur Krisenbewältigung reduziert.
3. Der soziale Abstieg: Isolation und Hoffnungslosigkeit:
- Verlust von Beziehungen: Sucht führt oft zu sozialem Rückzug, Jobverlust und dem Zerbrechen von Freundschaften. Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit wachsen. Stigmatisierung: Vorurteile und Ausgrenzung verstärken Scham und Schuld, erschweren den Weg zur Hilfe.
4. Verlust der Kontrolle: Impulsivität und Enthemmung:
- Drogen und Alkohol senken die Hemmschwelle und fördern impulsives Handeln. In Krisen werden suizidale Gedanken eher in die Tat umgesetzt.
Die Qual des Entzugs: Körperliche Entzugssymptome:
- Entzug kann mit starken körperlichen und psychischen Beschwerden einhergehen, die das Leid verstärken und das Suizidrisiko erhöhen.

Alarmstufe Rot: Warnsignale für Suizidgefahr bei Suchtkranken:
Achte auf diese Warnsignale, die auf eine erhöhte Suizidgefahr hinweisen können:
- Direkte oder indirekte Suizidäußerungen: „Ich will nicht mehr“, „Es wäre besser, wenn ich tot wäre“.
- Rückzug, Isolation: Verlust des Interesses an allem, Vernachlässigung von Kontakten.
- Hoffnungslosigkeit: Ausweglosigkeit, Sinnlosigkeit, Pessimismus.
- Starke Stimmungsschwankungen: Wechsel zwischen Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit und Aggressivität.
- Verändertes Schlaf- und Essverhalten: Schlaflosigkeit oder exzessiver Schlaf, Appetitverlust oder -zunahme.
- Selbstverletzung: Ritzen, Schneiden als Ventil für inneren Druck.
- Vorbereitungen: Abschiedsbrief, Verschenken von Besitztümern, Regelung von Angelegenheiten.
- Eskalierender Konsum: Mehr Drogen/Alkohol als Selbstmedikation oder Ausdruck der Verzweiflung.
- Beschäftigung mit Tod/Suizid: In Gesprächen, Zeichnungen, im Internet.
- Plötzliche Ruhe: Nach Phasen der Verzweiflung kann dies auf einen gefassten Entschluss hindeuten.
*Fiktiver Erfahrungsbericht:
„Ich habe angefangen, meine Sachen zu verschenken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich wollte einfach nur noch, dass der Schmerz aufhört.“ – Anna, 28
Wichtig: Einzelne Anzeichen sind nicht immer eindeutig, aber mehrere gleichzeitig sind ein ernstes Warnsignal.
Wege aus der Dunkelheit: Umfangreiche Hilfsangebote für Suizidrisiko und Sucht:
Es gibt zahlreiche Hilfen für Suchtkranke und Angehörige:
- Soforthilfe in Krisen:
- Telefonseelsorge: Anonym, kostenlos, rund um die Uhr (Deutschland: 0800 1110111 oder 0800 1110222, Österreich: 142, Schweiz: 143).
- Krisendienste und psychiatrische Notaufnahmen: Sofortige Hilfe in akuten Krisen.
- Notfall Apps Krisenkompass App und weitere.
- Suchtberatung:
- Örtliche Suchtberatungsstellen: Beratung, Information, Vermittlung (Adressen findest Du online, z.B. über die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) https://www.dhs.de/).
- Online-Beratung: Viele Beratungsstellen bieten auch Online-Beratung per Chat oder E-Mail an.
- Selbsthilfe:
- Selbsthilfegruppen: Anonyme Alkoholiker (AA), Narcotics Anonymous (NA), Kreuzbund, Blaues Kreuz, DRK und viele andere. Austausch mit anderen Betroffenen.
- Therapie:
- Qualifizierte Entgiftung: Medizinisch überwachter Entzug (stationär oder ambulant).
- Entwöhnungsbehandlung: Langzeittherapie zur psychischen Abhängigkeit (stationär oder ambulant).
- Psychotherapie: Behandlung von Begleiterkrankungen (Depression, Angst, Trauma) und Ursachenforschung.
- Sozialtherapie: Hilfe bei der Wiedereingliederung.
- Spezielle Angebote:
- Suchtberatung für Jugendliche: Spezielle Angebote für junge Menschen.
- Suchtberatung für Frauen: Angebote, die auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind.
- Suchtberatung für Migranten: Angebote in verschiedenen Sprachen und kultursensibel.

Unterstützung für Angehörige: Was Du tun kannst:
- Offenes Gespräch: Ängste ansprechen, Hilfe anbieten, ohne zu verurteilen.
- Zuhören: Verständnis zeigen, Gefühle ernst nehmen.
- Informieren: Wissen über Sucht und Hilfen aneignen.
- Grenzen setzen: Selbstschutz vor Überforderung, Co-Abhängigkeit vermeiden.
- Professionelle Hilfe: Betroffene ermutigen, Hilfe anzunehmen, begleiten.
- Selbsthilfegruppen für Angehörige: Al-Anon, Nar-Anon (Austausch und Unterstützung).
Fazit:
Sucht und Suizid sind eng verwoben. Risikofaktoren und Warnsignale zu kennen, ist lebenswichtig. Frühzeitige Hilfe ist entscheidend. Es gibt wirksame Hilfen, um den Weg aus der Krise zu finden.
Du kannst helfen:
Wenn Du selbst oder jemand, den Du kennst, Hilfe braucht: Zögere nicht! Es ist ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu holen. Teile diesen Artikel, um aufzuklären und Betroffenen Mut zu machen. Bei Fragen oder Anregungen kontaktiere mich gerne über die Kommentarfunktion & Social Media Möglichkeiten.
Quellenangaben:
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS): https://www.dhs.de/
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): https://www.bzga.de/ (allgemeine Infos zu Gesundheitsthemen)
- Stiftung Deutsche Depressionshilfe: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/ (Informationen zu Depression und Suizid)
- Nationale Suizidprävention Deutschland: https://www.suizidpraevention-deutschland.de/
Aktualisierungshinweis:
Dieser Artikel wird regelmäßig auf Aktualität geprüft und bei Bedarf überarbeitet.

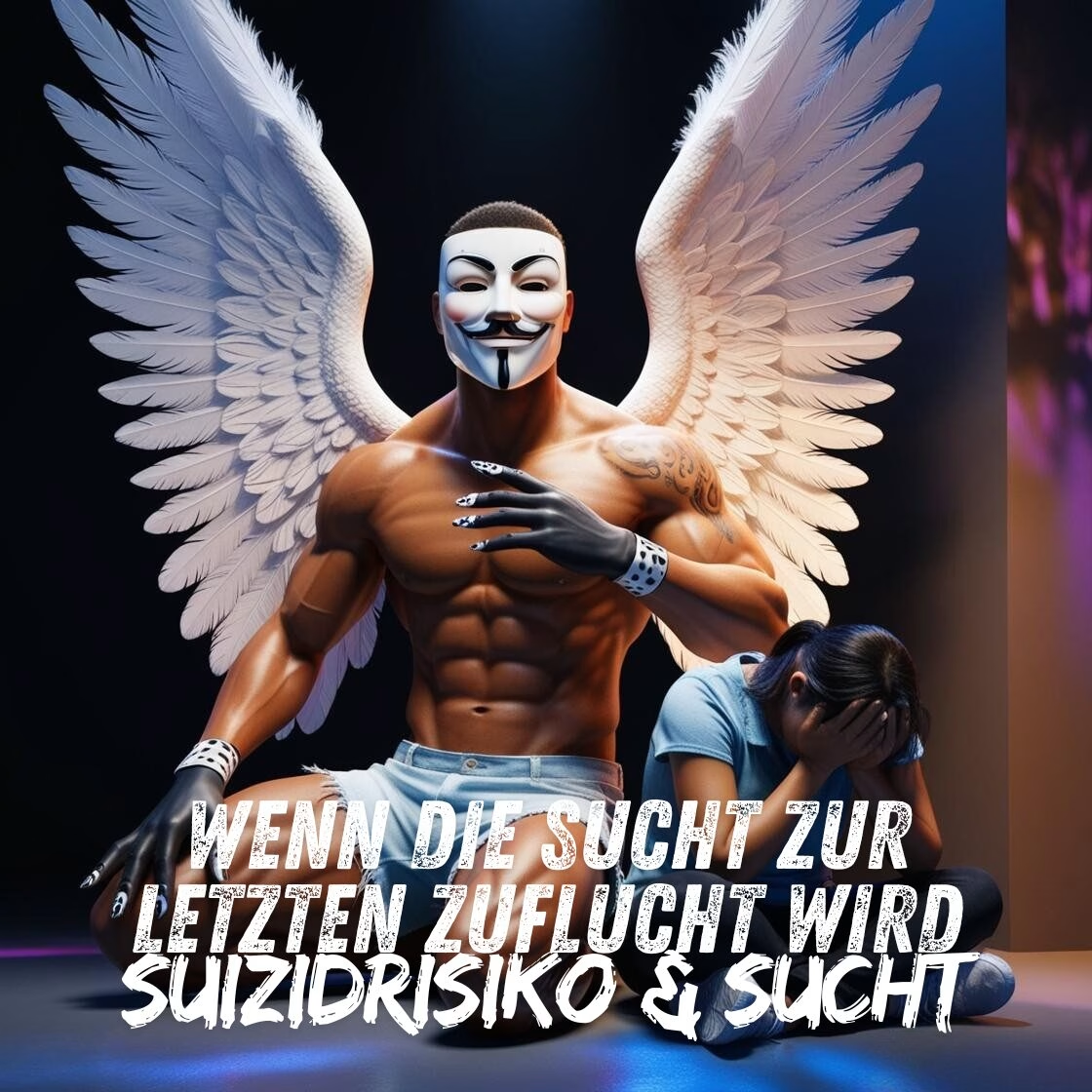
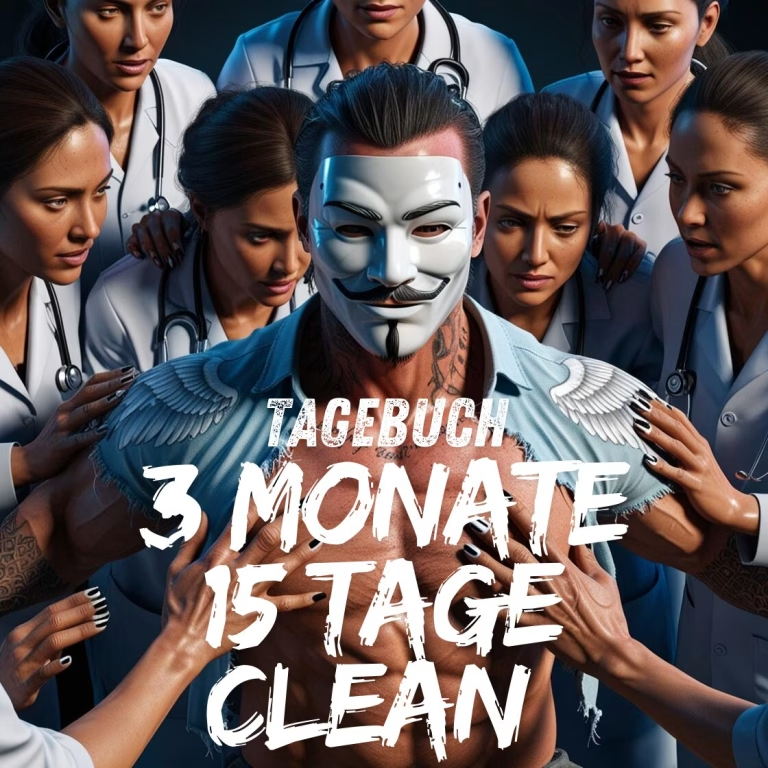
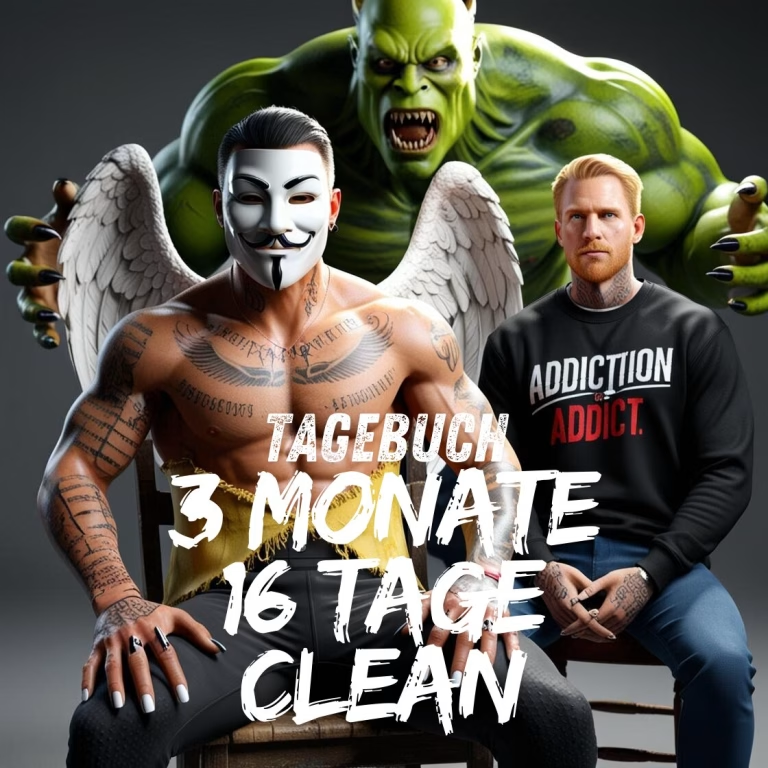
Leave a Comment